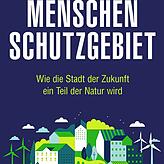Wenn es gut läuft, haben Kommunalpolitiker alle Belange ihrer Kommune im Blick und können auf Fragen stets aktuell und klug antworten. Mancher Rathauschef denkt dabei aber über den Tellerrand hinaus und entwirft große Linien, so wie Uli Burchardt. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Konstanz und hat ein lesenswertes Buch geschrieben.
In „Menschenschutzgebiet“ gewährt er tiefe Einblicke in seine Biographie und denkt darüber nach, wie Natur- und Klimaschutz in unseren Städten mit den Bedürfnissen der Menschen in Einklang zu bringen sind. Dabei formuliert er harte Kritik an zu engstirnigen Naturschützern.
Herr Burchardt, Ihr neues Buch ist ein Plädoyer für radikale Veränderung, sowohl von Stadtgesellschaften als auch von Lebensgewohnheiten, aber eben auch ein Plädoyer dafür, bei aller Dynamik die Menschen und ihre Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Also Vollgas und gleichzeitig bremsen?
Dieses Buch ist eine Beobachtung und addiert verschiedene Perspektiven. Ich glaube, dass wir radikale Veränderung brauchen. Darüber müssen wir eine große, gesellschaftliche Debatte führen und umdenken. In einer Demokratie müssen alle die Notwendigkeit zur Veränderung wollen und verstehen.
Aber es haben doch alle verstanden, dass Klimaschutz unausweichlich ist.
Nicht unbedingt. Ich sage ja immer, Klimaschutz ist keine Pizza. Ich kann mich nicht einfach aufs Sofa setzen, bestellen und warten, dass die Politik liefert, sondern dass es um ein Thema geht, das alle betrifft. Wir werden die großen Aufgaben nur lösen, wenn jeder akzeptiert, dass er einen kleinen Beitrag dazu leisten muss.
Haben Sie den Eindruck, dass das nicht der Fall ist?
Ich habe den Eindruck, dass jeder erwartet, dass jemand anders das Problem löst. Aber die Einsicht, dass jeder von uns mit rund elf Tonnen CO2 pro Jahr zum Gesamtausstoß beiträgt, die muss dazu führen, dass jeder von uns etwas ändern muss. Das ist so aber noch nicht akzeptiert. Die Diskussion ums Heizungsgesetz hat es gezeigt. Da macht einer einen Vorstoß und sagt, dass man an das Thema mal ran muss, und sofort rollt die Welle der Empörung los. Das passt so nicht.
Klima- und Naturschutz steht eben häufig im Spannungsfeld zu Gewohnheiten der Menschen. Dann steht die Natur als schützenswert hier und der Mensch als Schädling da. Gegen diese Sichtweise wehren Sie sich?
Allerdings. Es gibt immer mehr Gebiete in unserem Land, da sind Menschen ausgesperrt. Da wird irgendwo ein Naturschutzgebiet ausgewiesen und ein Schild aufgestellt mit den Worten „Betreten verboten“. Die Botschaft ist dann: Hier endet der Mensch, dort beginnt die Natur. Und der Mensch hat in dieser Natur nichts verloren, weil er sie beschädigt. Aber wir müssen nicht die Natur vor uns Menschen schützen, sondern wir müssen uns Menschen vor der Natur schützen. Sonst macht sie uns platt.
Wie meinen Sie das?
In der Natur bleibt nichts jemals gleich, alles ist in Veränderung. Das ist ganz normal. Ein Beispiel: Wenn ein Berg abrutscht oder ein See austrocknet, ist das der Natur doch völlig egal, das spielt ökologisch betrachtet kaum eine Rolle. Aber für uns ist das ein Riesenproblem, denn unser Lebensraum wird so zerstört. Wir Menschen brauchen den See und das Wasser. Die Natur nicht. Wenn wir uns also nicht ums Klima kümmern, wird die Natur uns das Leben in vielen Regionen unmöglich machen.
Auch Nichtregierungsorganisationen nehmen solch radikale Positionen ein, beispielsweise Attac oder der Nabu. Sie waren bei beiden überzeugtes Mitglied, sind aber ausgetreten. Ist das nicht ein Widerspruch?
Meine Beziehung zu Attac war immer differenziert und ist dann endgültig an deren kritischer Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine zerbrochen. Ich habe die Waffenlieferungen immer entschieden für richtig und notwendig gehalten. Beim Nabu lag die Sache ganz anders.
Ich glaube, dass sich unsere großen Naturschutzverbände stark ändern müssen. Sie nehmen immer nur die Natur in den Fokus, denken zu wenig auch an Mensch und Ökonomie. Das funktioniert so nicht mehr. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo ökologisch sinnvolle Projekte deshalb nicht mehr weiterverfolgt werden konnten.
Ein Beispiel würde reichen.
In Konstanz wollen wir einen Wasserbus einrichten, um Menschen ohne Auto in die Innenstadt zu bringen. Das macht Sinn, wir reduzieren so Autoverkehr, den Anlegesteg gibt es auch schon. Aber wir diskutieren seit Jahren über geschützte Algen, über Wasservögel und so weiter. Der Wasserbus fährt immer noch nicht. Auch hohes Seegras darf man praktisch nicht mehr mähen. Viele Menschen bekommen beim Schwimmen aber Angst, wenn sie da hineingeraten.
Im Buch verwenden Sie dafür den Begriff Naturschutzindustrie. Was meinen Sie damit?
Der provoziert ein wenig, das ist mir klar. Gemeint ist damit ein Netzwerk aus Verbänden, Experten und Gutachtern, die nur ein Ziel verfolgen, nämlich ein bestimmtes Rechtsgut an einer bestimmten Stelle zu schützen und den Menschen einzubremsen. Der Blick aufs Gesamtsystem wird vernachlässigt.
Wie kann sich das denn ändern?
Ich fordere eine grundsätzliche Debatte, was eigentlich Naturschutz ist. Und ich sage, dass der Mensch Teil der Natur ist. Wenn wir eine klimaneutrale Stadt haben wollen, dann müssen sich auch Naturschützer bewegen. Der Naturschutz muss auch die Menschen berücksichtigen. Und er darf nicht über der Politik stehen.
Sie sagen, Naturschützer sind zu eindimensional, Medien berichten zu negativ und es gibt zu viele und enge Gesetze. Aber singen das Hohelied auf den eigenen Gemeinderat und auf die eigene Stadtverwaltung. Kommunale Selbstkritik klingt anders, täuscht das?
Ja, das täuscht. In meinem Buch steht nirgends, dass wir Kommunalen alles richtig machen. Ich werbe aber für Vertrauen in die Gremien und die Menschen, die vom Volk gewählt worden sind. Und wir sind an einem Punkt, wo Politik an vielen Stellen fast nichts mehr entscheiden kann, weil sie an bürokratische Hürden stößt. Ein guter Teil davon ist eine hart restriktive Naturschutzbürokratie.
Eine Ihrer ersten Erkenntnisse als OB war, dass in Verwaltungen alles viel langsamer geht, als man denkt. Jetzt sind Sie zwölf Jahre im Amt. Ist Ihre Verwaltung in Sachen Stadtentwicklung und Klimaschutz inzwischen ein Rennpferd?
Ich denke schon, dass wir zu den schnellsten gehören in Deutschland. Und ich glaube, da, wo wir nicht vorwärtskommen, liegt das zu einem guten Teil auch an Gründen außerhalb unserer eigenen Organisation.
Also doch an den anderen.
Nein, nicht an den anderen, sondern an den Rahmenbedingungen. Ein Beispiel: Wenn ich Flächenverbrauch stoppen will, dann kann ich den doch nicht ernsthaft in einer wachsenden Stadt wie Konstanz gleichermaßen stoppen wie in einer schrumpfenden Stadt, sondern ich muss das Gesamtsystem betrachten und ausgewogen handeln.
Sie denken in großen Linien und weniger im kleinen Karo. Verstehen Sie so auch Ihr Amt?
Ja, es ist der Job eines OBs, sich Gedanken zu machen, was heute getan werden muss, dass es seiner Stadt auch in 20 oder 50 Jahren noch gut geht.
Es gibt Stimmen, die kritisieren, dass ein OB einer 87.000-Einwohner-Stadt die Welt retten will.
Ich habe nicht den Anspruch, die Welt zu retten. Ich habe den Anspruch, eine Perspektive dazu beizutragen.
Ist das auch Teil der Antwort auf die Formulierung von Kritikern, die sagen: Für mein Fest oder Jubiläum hat der OB keine Zeit, aber für ein Buch kann er sie sich nehmen?
Ja, das ist ein Teil der Antwort. Es gab nie einen Fall, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht zu einem Vereinsfest, sondern muss schreiben. Ich habe dieses Buch in meiner Freizeit verfasst. Auch ein OB hat Freizeit, beispielsweise frühmorgens oder im Urlaub.
Trifft Sie die Kritik?
Ja, total. Weil ich alles, was ich kann und habe, in dieses Amt investiere. Ich würde es niemals vernachlässigen.
Es gehört doch aber zum Amt, kritisiert zu werden, zum Beispiel auch vom SÜDKURIER. Sie haben mal gesagt, Sie lesen ihn nicht mehr, weil Sie sich zu häufig über Inhalte ärgern. Aber über das neue Buch möchten Sie mit dem SÜDKURIER sprechen. Wie passt das denn zusammen?
Klar, es gab Berichte, über die ich mich geärgert habe. Es gab auch Phasen, in denen ich nicht mehr in die Zeitung geguckt habe. Aber ich lese den SÜDKURIER selbstverständlich wieder. Ohne Journalismus keine Demokratie. Und ich freue mich darüber, dass wir heute über mein Buch sprechen und ich den Inhalt hier erklären kann. Mir ist schon klar, dass so ein Buch auch Fragen aufwirft. Deshalb habe ich auch im Buch selbst ein paar Seiten dazu geschrieben, wie das Buch entstanden ist.
Wer das Buch liest, versteht Sie auch als Mensch ein wenig besser. War das eine Motivation?
Kaum. Das Buch enthält viele persönliche Momente, das stimmt. Das trägt vielleicht zu einem besseren Verständnis meiner politischen Sicht bei. Die persönlichen Geschichten habe ich aber vor allem einfach gerne erzählt, sie zu schreiben hat mir viel Spaß gemacht. Und das Buch zeigt auch, dass sich das Aufgabenspektrum eines OB in den letzten Jahrzehnten doch sehr geändert hat.
Das heißt, die Fest- und Vereins-Besuche von einst werden weniger?
Nein, aber in Konstanz werden die Feste immer mehr (lacht).
Im Buch resümieren Sie, dass die Klimaziele bis 2035 so nicht zu schaffen sind, auch Konstanz erreicht seine Etappenziele nicht. Raubt Ihnen das den Schlaf?
Nein, ich denke, dass Etappenziele nicht so wichtig sind. Es kann durchaus sein, dass man mal ein Zwischenziel verpasst, am Ende aber doch alle Ziele erreicht. So kann es sein, dass man beim Wärmenetz jahrelang nichts sieht. Wenn es aber ans Netz geht, ist der Effekt aufs Klima sprunghaft und groß. Oder das Beispiel Biogas-Fähre. Wenn wir die heute in Betrieb nehmen, sparen wir auf einen Schlag 700.000 Liter Diesel im Jahr. Das sind tolle Entwicklungen.
Gutes Beispiel. Die Fähre kostete fast 28 Millionen Euro. Klimaschutz muss man sich auch schon leisten können. Wo sollen die Mittel dafür herkommen?
Das kann nur dann funktionieren, wenn es Investitionen sind, für die ich einen Businessplan schreiben und einen Return on Investment planen kann. Die Fähre rentiert sich ja, sie verdient Geld für uns alle.
Also werden neue Schulden aufgenommen?
Das wird nicht anders gehen, da bin ich ganz bei unserem Ministerpräsidenten.
Das nennt man dann Klimaschutz auf Kosten nachwachsender Generationen?
Ja, was Kredite anbelangt schon. Aber nachwachsende Generationen werden von diesen Investitionen profitieren, auch wirtschaftlich. Wenn wir beispielsweise jetzt viel Geld ins Wärmenetz investieren, werden die nächsten Generationen klimafreundlicher und auch wirtschaftlich heizen.
Ist die Menschheit denn überhaupt noch zu retten?
Ich bin überzeugt davon, ich bin ein Optimist. Die Menschen werden weltweit immer mehr in Städte ziehen. Wenn wir es schaffen, die Stadt als Ökosystem zu begreifen und klimaneutral neu zu erfinden, dann haben wir eine wesentliche Lösung für das Überleben der Menschheit auf der Welt gefunden. Und zu dieser Riesendebatte ist mein Buch hoffentlich ein ganz kleiner Beitrag.