Es war ein Mittwoch, als französische Besatzungsoffiziere am 30. Mai dem damaligen Gailinger Bürgermeister Josef Ruh den Befehl zur Evakuierung der Gailinger Bevölkerung überbrachten. Einen Tag vor Fronleichnam galt es, den Grenzbereich zu räumen. „Auf Fragen des Bürgermeisters, von wem der Befehl komme und was die Gründe seien, wurde militärisch knapp erwidert, dass Deutschland bedingungslos kapituliert habe und es sich um eine militärische Anordnung handele“, berichtet der Gailinger Ortshistoriker Gerold Auer, der sich zu diesem Jahrestag tief in die Archive eingearbeitet hat.
Er ist Mitarbeiter der Gemeinde Gailingen im Gemeindearchiv und hat zum 75. Jahrestag der Evakuierung in umfangreich im Staatsarchiv St. Gallen sowie der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern geforscht. Seine Erkenntnisse sind auch fünf Jahre später, zum 80. Jahrestag, aktuell.
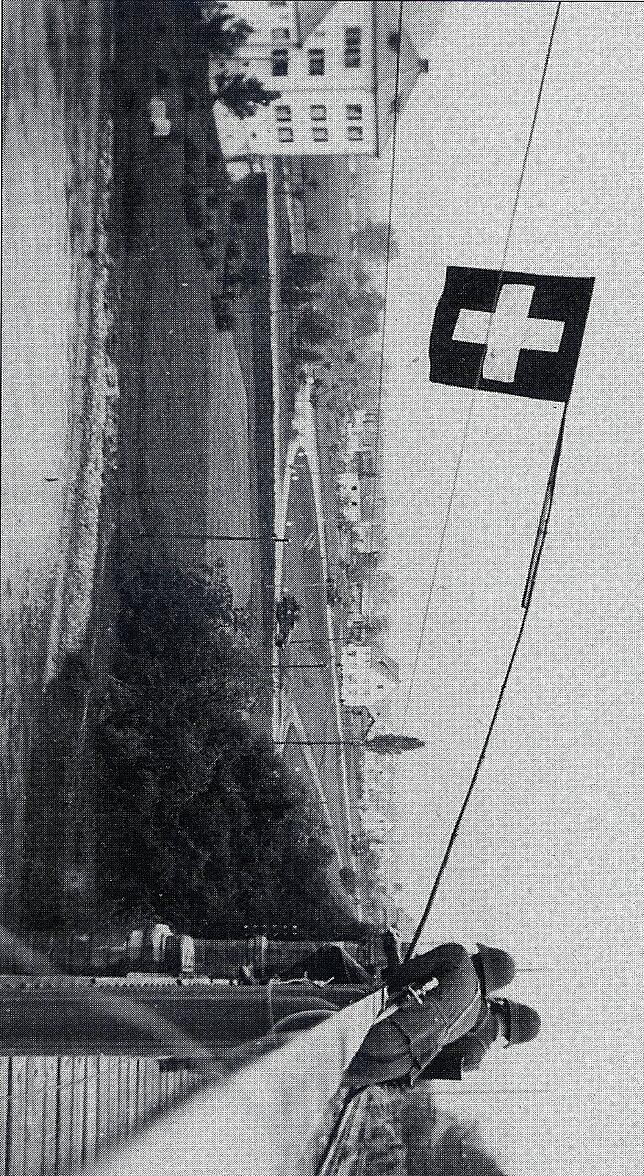
Ein Blick auf die Landkarte macht dann auch schnell klar, weshalb man räumte: Der verzipfelte Grenzverlauf wurde so begradigt. Die zu überwachenden Grenzlinien verkürzten sich beträchtlich. Eine Erkenntnis, die auch der an Geschichte interessierte Helmut Fluck zu diesen Zeiten fand: „Die Besatzungsmächte setzten nach und nach ihre eigenen Ideen in die Tat um.“
Am nächsten Tag schon sollten sich die Einwohner auf den Weg nach Welschingen, Immendingen, Möhringen, Hattingen und Emmingen ab Egg machen. „Wie ein Lauffeuer ging die Hiobsbotschaft durch den Ort“, berichtet Auer. Morgens früh um sechs Uhr sollte alles abmarschbereit sein.
Bittgesuch wird zwei Wochen später abgelehnt
Eine ungeheure Aufregung habe das Dorf ergriffen und die wildesten Gerüchte gingen um. Ein Bittgesuch von Bürgermeister Josef Ruh und Pfarrer Ferdinand Kleibrink an General Jean de Lattre de Tassigny wurde erst zwei Wochen später beantwortet – es kam eine schriftliche Ablehnung.
Während der ganzen Nacht – die verhängte Ausgangssperre war aufgehoben – packten, verluden und verstauten die Einwohner ihre Habe, um am Tag darauf loszumarschieren. Traktoren hatten die wenigsten, aber die Bauern hatten glücklicherweise große Wagen. Die Nichtlandwirte bepackten, soweit sie hatten, Handwagen und alte Kinderwagen. Rund 1600 Gailinger standen mit Viehgespannen, Leiterwagen und Habseligkeiten bereit zum Abmarsch an jenem sonnigen Fronleichnamstag.
Manche Bauern hatten mehrere Kühe vor den Wagen gespannt, an denen dann viele kleine Handwagen, zu einer langen Kette zusammengebunden, angehängt wurden. Dies war auch bei den wenigen von Traktoren gezogenen Wagen der Fall. Selbst Hühnerställe mitsamt Hühnern waren auf die Wagen geladen worden.
Endlose Karawane von Viehgespannen
Leo Schreiber hat die Evakuierung als 16-Jähriger erlebt und damals die Ereignisse schriftlich festgehalten. „Gegen acht Uhr fuhren wir weg“, notierte er, wie es in der SÜDKURIER-Serie „Gedächtnis der Region“ dokumentiert wurde. Eine endlose Karawane von Viehgespannen, auch Leiterwägelchen. „Auch wir hatten unsere ganze Habe auf einem solchen.“
Wie viele andere hängte Schreibers Familie ihr Kärrele an den einzigen Traktor im Dorf – den der Dreschgenossenschaft. Viehgespanne zogen ebenfalls lange Ketten von Leiterwagen. Kinderwagen waren mit Lebensnotwendigem bepackt. Der Marsch brachte viele Menschen und die Zugtiere an den Rand der Erschöpfung.

„In Randegg schaute die dortige Bevölkerung mit Entsetzen ihren durchziehenden Nachbarn hinterher“, erinnert sich Zeitzeuge Dieter Fleischmann an den Prozessionszug. In Gottmadingen sei die Spitze des Gailinger Zuges auf die dortige Fronleichnamsprozession gestoßen und Pfarrer Burkard segnete die vorbeiziehenden Gailinger.

Vor den Toren Hilzingens wurde der Zug gestoppt und es musste mit der dortigen Kommandantur zuerst um Durchzug verhandelt werden. Am späten Nachmittag, nach langer Wartezeit, ging es endlich weiter Richtung Welschingen. „Keiner ahnte, dass das Hegaudorf Welschingen in den nächsten Wochen und Monaten zum Dreh- und Angelpunkt werden sollte“, berichtet Gerold Auer.
Mensch und Tier waren erschöpft, als der Zug spät abends Welschingen erreichte. Welschingens Bürgermeister Adolf Heiß habe Herz für die Ankommenden gezeigt, gestattete Aufenthalt und ordnete die Öffnung der Scheunen des Ortes an. „Dank der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Welschinger Bevölkerung konnten Mensch und Vieh untergebracht und verpflegt werden“, so Auer.

Als sich der Zug am Samstag, 2. Juni, auf den Weg zu den Zielorten Immendingen, Möhringen, Hattingen und Emmingen ab Egg machte, wurde die Situation immer unübersichtlicher. „Die Ortskommandanten lehnten die Aufnahme ab“, berichtet Auer vom Tross, der wieder zurück in den Hegau kam. „Auch hier nahm die gastfreundliche Gemeinde Welschingen die meisten Gailinger wieder liebevoll auf. Hier lebten zeitweise mehr evakuierte Gailinger als Welschinger Einwohner“, erinnert der Ortshistoriker an Wochen, in denen Welschingen zu Klein-Gailingen wurde.

Die rund 800 Welschinger beherbergten über 1600 Gailinger. „Nach Angaben von Zeitzeugen war die Bevölkerungszahl mit Gailingern und den Flüchtlinge aus dem Osten auf über 2000 Menschen angewachsen“, so Helmut Fluck. Die Dankbarkeit der Gailinger an jene Tage wird durch ein Erinnerungsbild deutlich, das auch heute noch im Gasthaus Bären in Welschingen zu sehen ist.
Trotz vieler Gesuche und Bitten kirchlicher Organisationen wurde die Situation nicht besser. Auch als schließlich Geistliche die Erlaubnis erhielten, die Menschen in den Aufnahmeorten zu besuchen, änderte sich wenig. Erst am 15. Juli wurde die Evakuierung für Gailingen und Wiechs teilweise aufgehoben und immerhin die Landwirte konnten zur Heuernte in die Heimatorte zurück.
Die anderen blieben voller Neid und Unmut zurück. Sie mussten weiter ausharren, bis am 18. August 1945, rund zweieinhalb Monate später, die Evakuierung aufgehoben worden ist und auch sie wieder in ihre Heimatorte zurückkehren konnten.
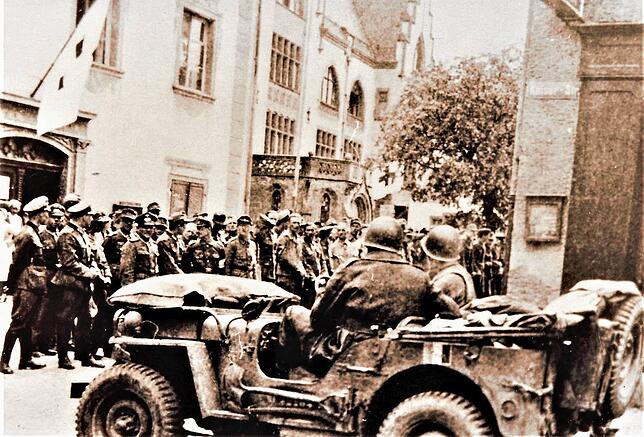
Dieser Artikel erschien erstmals im Mai 2020.
Warum Gailingen, Wiechs und zuvor Jestetten evakuiert wurden
- Die Sorgen: Die Vertriebenen fragten sich von Anfang an, warum sie evakuiert werden. Da von den französischen Offizieren kein Grund für den Befehl genannt worden war, gab es viele Spekulationen: Im so genannten Jestetter Zipfel mit den Ortschaften Jestetten, Lottstetten, Altenburg und Baltersweil, die auf Befehl der französischen Besatzungsmacht bereits am 14. Mai 1945 ihre Dörfer räumen mussten, fragten sich die Leute, ob ihr Gebiet möglicherweise an die Schweiz abgetreten werden soll. Oder ob es eine Vergeltung für die Hinrichtung eines polnischen Kriegsgefangenen im Jestetter Zipfel ist? Gab es versprengte SS-Einheiten, die man ohne Bevölkerung leichter bekämpfen konnte? Wie sich Jahrzehnte später herausstellte, war der Grund die militärische Sicherung der unübersichtlichen Grenze zur Schweiz im Jestetter Zipfel und um Gailingen. Büsingen war nach Kriegsende zwar von ein paar französischen Soldaten besetzt, wurde aber nicht evakuiert.
- Die Gründe: Der Schaffhauser und Wahl-Lottstetter Josef Eisenlohr hat über die Evakuierung des Jestetter Zipfels nachgeforscht. Eisenlohrs Recherchen im französischen Armeearchiv von Vincennes liefern Hinweise darauf, dass die Evakuierung vor allem die Sicherung der Grenze vereinfachen sollte. Das alliierte Oberkommando unter General Dwight Eisenhower hat schon im September 1944 verfügt, um ganz Deutschland ein fünf Kilometer breites Sperrgebiet einzurichten. Kriegsverbrecher sollten so an der Flucht ins Ausland gehindert werden. Später beschlossen die Siegermächte, lediglich entlang der Schweizer Grenze von Basel bis Konstanz ein Sperrgebiet zu schaffen. Der Chef de la Division Documentation, Etudes, Publications im französischen Armeearchiv in Vincennes bei Paris beurteilt nach Sichtung der Dokumente die Vorgänge um Jestetten so: „Die Schaffung des Sperrgebietes war zweifellos der Grund, die drei Dörfer zu evakuieren.“ Das Archiv fasste im Herbst 1996 die Aktenlage in einem Schreiben an Eisenlohr zusammen. Dabei zeigte sich, dass die Operation Sperrzone im Befehl des 2. Armeekorps Nr. 178 vom 30.4.1945 geregelt und in einem Anhang vom 1. Mai präzisiert wurde. Am 3. Mai gab General Salan als Oberkommandierender der 14. Division den Befehl, die Grenze zur Unterbindung von Absetzaktionen der NS-Grössen in die Schweiz zu schließen. Die Hauptverkehrswege wurden gesichert und die Zone von versprengten Militärs gesäubert. Am 27. Mai erhielt der Colonel der Konstanzer Abteilung den Auftrag, mit den Dörfern Wiechs und Gailingen wie mit Jestetten zu verfahren.







