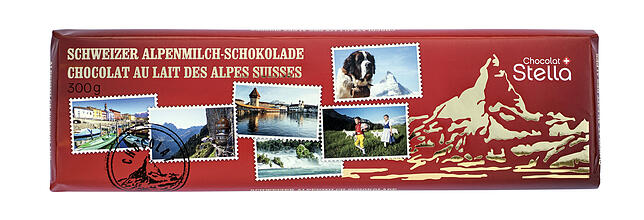Messerscharf
Jeder kleine Junge hat einmal ein Taschenmesser, oder? Doch Taschenmesser ist nicht gleich Taschenmesser. Der Endgegner unter dem aufklappbaren Schnitzwerkzeug ist das Schweizer Armeemesser der Marke Victorinox. Denn das kleine Wunder ist nicht nur zum Schnitzen da. Beispielsweise lässt sich damit ganz lässig der Kronkorken von einer Rivella streifen.
Doch übersteigen die fast grenzenlosen Möglichkeiten unsere Vorstellungskraft um Längen. In Verbindung mit einer Büroklammer und Klebeband konnte MacGyver mit dem Messer Bomben entschärfen. Doch damit nicht genug: Man kann Haare schneiden, jede beliebige Dose öffnen, Raketen bauen. Oder jemanden zusammenflicken, der sich bei Versuch, ein Stück Toblerone abzubeißen, den Gaumen aufgerissen hat.
Gerade in der aktuellen Jahreszeit auch besonders nützlich: die Säge. Wer sich beim winterlichen Spaziergang in eine Nordmanntanne verliebt, kann sich diese einfach absägen und ins Wohnzimmer stellen. Das Alleinstellungsmerkmal des Schweizer Offiziersmessers ist allerdings: Es lässt sich nicht nicht zum Zerschneiden von Gegenständen nutzen, sondern durch viele Funktionen auch zum Reparieren. Mit der Zange beispielsweise lässt sich die Deutsch-Schweizerische Freundschaft bestimmt noch ein klein wenig enger zusammendrehen.
Frank Hohlfeldt
Die zarteste Versuchung seit es Fleisch gibt
Ein saftiges St.-Galler-Brot, bestrichen mit Appenzeller Butter, wird zur Perfektion, wenn es mit ein paar Scheiben Bündnerfleisch belegt wird und darauf ein paar Tropfen Olivenöl und frisch gemahlener Pfeffer kommen. Der Geschmack ist so intensiv und überwältigend, dass mir sofort Goethe in die Sinne kommt: Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: Verweile doch, du bist so schön!
Die Fleischspezialität kommt aus dem Kanton Graubünden. Zur Herstellung wird das magere Fleisch aus der Rindkeule getrocknet. Die frisch geschlachteten Fleischstücke werden mit Pökelsalz, Alpenkräutern und einer Gewürzmischung eingerieben, die bei jedem Hersteller, wer hätte das gedacht, Betriebsgeheimnis ist. Danach werden die Stücke mehrere Wochen bei tiefen Temperaturen gelagert. Während dieser Lagerzeit wird das Fleisch mit Salz, Kräutern und Gewürzen durchzogen. Gleichzeitig wird dem Fleisch Flüssigkeit entzogen.
Anschließend werden die in Netze gebundenen Fleischstücke bei zwölf Grad in der frischen Graubündner Bergluft getrocknet. Dabei werden sie mehrfach kontrolliert, um den hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten. Außerdem werden sie mehrfach gepresst, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig im Fleisch verteilt. Durch das Pressen erhält das Bündnerfleisch seine charakteristische rechteckige Form. Bündnerfleisch – die zartest Versuchung seit es Fleisch gibt.
Andreas Schuler
Ich liebe Käse!
Wenn man so will, lässt sich mein Leben in diesen drei Worten beschreiben. Das Leben ist mit Käse überbacken einfach besser. Die Liebe zum Käse teilen auch unsere Schweizer Nachbarn. Denn schließlich haben sie das berühmte Käsefondue ins Leben gerufen, ein käsiges Meisterwerk. Frei nach dem Motto „Käse kann man nie genug haben“ werden beim Fondue allerlei Speisen in Käse gedreht, damit verschmolzen und so zu einer Geschmacksexplosion für den käseliebenden Gaumen.
Eine geschulte Nase riecht das Käsefondue schon von weitem: Denn wenn Käsesorten wie Vacherin und Greyerzer im Topf langsam vor sich hinschmelzen, riecht das zehn Meilen gegen den Wind, ungefähr so wie der Käsestand auf dem Wochenmarkt. Wer kann bei dem Geruch von Käsefondue schon widerstehen? Wenn unsere Schweizer Nachbarn in Kreuzlingen mehr Käsefondue essen würden – da bin ich mir sicher – würde so manche Konstanzer Nase wie von Zauberhand über die Schweizer Grenze laufen.
Dazu muss nur der Wind richtig stehen und die Käseliebhaber mit dem Duftmix aus Bergkäse und Weißwein anlocken. Denn die folgen in ihrem Leben ganz gerne mal dem Motto: Immer dem Käse nach. Und so führen alle Wege früher oder später zum gemeinsamen Schweizer Käsefondue. Käse verbindet.
Wiebke Wetschera
Das Biberli
Das Beste kommt zum Schluss: Wer mit der Fluggesellschaft Edelweiß unterwegs ist, darf sich am Ende der Reise in der Kabine auf das Biberli freuen. Ein Lebkuchen, der Appenzeller Biber.
Aber nicht irgendein Lebkuchen, „der“ Lebkuchen aus der Schweiz. Und er soll, wenn man so will, Verbindung zu Konstanz haben. Bimenzelte lautete wohl die ursprüngliche Bezeichnung für diesen Snack. Biment sagten die Ostschweizer und Konstanzer im 14. Jahrhundert zu Nelkenpfeffer. Die Gewürzmischung aus Honigteig enthält eine Mandel- und Nussfüllung. Die Süßspeise soll nachweislich seit dem 16. Jahrhundert im Appenzellerland hergestellt werden.
Traditionell werden auf die Biber und ihre kleinen Geschwister, die Biberli, Bilder geprägt. In der Regel sind das Bären, das Wappentier der Appenzeller. Bei Edelweiß ist das anders. Dort ziert die gleichnamige Blume das Biberli. Macht aber nichts, schmeckt trotzdem. Am besten mit einem Glas Rivella, so etwas wie das nicht alkoholische Nationalgetränk der Schweizer, dazu.
Philipp Zieger
Als Geschmacksverstärker noch erlaubt waren
Schon dieser formvollendete Streuer: Gelb und rot dominieren, was will der Badener da noch mehr? Denke ich an den samstäglichen Einkaufsbesuch in der Schweiz, komme ich am Geschmack von Mirador nicht vorbei: Sehr Salzig, irgendwie aber auch süßlich, auf jeden Fall aber wahnsinnig intensiv.
Nach heutigen Standards dürfte die sogenannte Streuwürze als potenziell gesundheitsschädigend gelten. Schon nach der Hauptzutat Kochsalz folgt: Mononatriumglutamat. Ja genau, das ist der verrufene Geschmacksverstärker, der uns süchtig nach immer mehr macht. Was sonst noch drin ist? Maltodextrin, also eine Zuckerform. Dann noch normaler Zucker, getrocknete Zwiebeln, ein Hauch Palmöl, einige Gewürze und Aromen.
Ungesund? Völlig egal, hart gekochte Eier oder auch nur ein Butterbrot voll mit dem gelben Pulver haben mich zufrieden gestimmt. Nur eines mache ich bis heute falsch: Wie meine Mutter nenne ich es Fondor, dabei ist das der Konkurrent des Markenherstellers mit deutschem Sitz in Singen.
Benjamin Brumm
Zum Dahinschmelzen
Gemütlich brutzelnde Pfännchen, ungeduldiges Warten auf geschmolzenen Käse, leicht angebrannte Aromaschwaden im Wohnzimmer: es ist wieder Raclette-Zeit. Der Boom des Selbst-Kochens am Tisch im Familien- oder Freundeskreis ist ungebrochen. Vor allem an Weihnachten und Silvester wird bei uns zu Hause der übers Jahr angestaubte Raclette-Grill aus dem Kellerregal geholt.
Bei den Zutaten kennen wir Deutschen ja kaum Grenzen– ganz im Gegenteil zu den Schweizern. Dort kommt nur Käse in die Pfännchen. Über unsere Einfälle wird jenseits der Grenze deutlich die Nase gerümpft. Aber wir haben Spaß in unserer Familie, die Kreativität in der Pfanne richtig auszuleben. Alle möglichen Fleischsorten, Bacon, Schinken oder sogar Hackfleisch, auf das meine Kinder besonders abfahren. Buntes Gemüse, Pilze und Eingelegtes. Oder auch die herzhafte-süße Variante mit Obst.
Ganz Mutige interpretieren die Käse-Schmelzerei gleich länderübergreifend mit Curry oder, etwas näherliegend, Maultauschen aus meiner schwäbischen Heimat. Was am Ende alles verbindet ist halt der wahnsinnig zarte, aromatische Raclette-Käse aus der Schweiz. Und bei dem machen wir keine Experimente.
Matthias Kiechle
Bircher Müsli. Um genau zu sein: Bircher Müesli
Erfunden hat's der Aargauer Arzt Maximilian Oskar Bircher-Benner um 1900. Bei einer Wanderung in den Alpen soll ihm eine Sennerin eine Mischung vorgesetzt haben aus Haferflocken, Nüssen, Äpfeln und gezuckerter Kondensmilch.
Ins Tal hinab war Bircher-Benner dann ziemlich schnell – vielleicht auch, weil er die Geschäftsidee seines Lebens hatte. In seinem Zürcher Sanatorium bot er seinen Gästen daraufhin erfolgreich eine "Apfeldiätspeise" an, garniert mit heute fragwürdigen Ernährungstheorien. Die Erfindung soll nicht nur ihn einige Fränkli reicher gemacht haben. Sondern später auch andere, die eine Fertigmischung mit seinem Namen ins Supermarkt-Regal stellten und das Schweizer Hafermus somit weltweit bekannt machten.
Dabei ist Bircher Müsli sehr einfach selbstgemacht – man braucht nur wie so oft in der Schweiz etwas Zeit: Einen Esslöffel Haferflocken über Nacht in drei Esslöffeln Wasser einweichen, am Morgen etwas Zitronensaft und Milch hinzufügen, einen säuerlichen Apfel darüber reiben, Haselnüsse und Mandeln dazu.
Sandra Pfanner
Die beste Schokolade der Welt
Es ist schon eine liebgewonnene Tradition geworden, kiloweise Gastgeschenke mit in den Urlaub zu nehmen. Ob Freunde, private Vermieter oder der Zimmerservice – alle freuen sich über eine Kleinigkeit aus unserer Heimat. Die Heimat kennt in diesem Fall keine Grenzen, denn das begehrteste Mitbringsel – sei es in Neuseeland, in den USA, in Marokko oder Indien – ist seit Jahren Süßes aus Kreuzlingen, von Chocolat Stella Bernrain.
In aller Herren Länder sind die Reaktionen meist gleich. Vorfreude: „Oh, Schokolade aus der Schweiz! Die soll doch die beste der Welt sein, oder?“ Dann eine kleine Enttäuschung, wenn die Tafel keinen der großen globalen Marken trägt. Ist die Verpackung dann aber geöffnet und die Schocki probiert, wollen alle mehr davon.
Die manchmal auch dank der süßen Präsente gewonnenen Freunde sind durch die Bank begeistert von unseren Geheimtipps, die bei den Beschenkten meist nur eine kurze Haltbarkeit haben. Zu schnell ist alles weggegessen. Wieder zu Hause angekommen, freuen wir uns schließlich doppelt. Einmal darüber, dass wir anderen eine Freude machen konnten. Und dann natürlich gleich schon auf die nächste Reise, vor der wir dringend zum Einkaufen nach Bernrain fahren müssen.
Ingo Feiertag
Kaba ist tot – es lebe Ovomaltine
Hesch dini Ovo hüt scho gha? Wem dieser Satz flüssig über die Lippen geht, der ist eindeutig dem Kanton Bern zuzuordnen; vielleicht kommt er oder sie ja sogar aus Neuenegg, wo Ovomaltine hergestellt wird, ein – ganz nüchtern ausgedrückt – Pulver, dessen größter Anteil Gersten-Malz-Extrakt ist und das sich in warme oder kalte Milch einrühren lässt.
Aber damit ist Ovomaltine nicht mal annähernd beschrieben. Mir geht zwar als gebürtigem Rheinländer der schwyzerdütsche Satz nicht mal dickflüssig über die Lippen – das Malzgetränk dafür umso flüssiger. Obwohl: Nur die orginale Variante, die in der Schweiz zu bekommen ist. Denn die hat eine andere Rezeptur als die Version für den Rest der Welt. Kein Witz. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden...
Ursprünglich als eine Art Medizin für "geistig und körperlich erschöpfte" Zeitgenossen entwickelt, hat die Marketing-Maschine heute zahlreiche Produkte rund um das magische Basis-Pulver erfunden: Riegel und Müslis und Energy Drinks und Schokoloade und Kekse, dazu Sonnenbrillen, Tassen, Schwimmsäcke und Bommelmützen. Wenn überhaupt, dann kann davon noch der Crunchy Cream Brotaufstrich mithalten, die Konsistenz ist einfach – ja, crunchy. Aber am Liebsten ist mir immer noch: Eiskalte, frische Milch im Glas, mit zwei Löffeln Ovo drin. So schmeckt für mich die Schweiz.
Sebastian Pantel