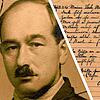Herr Klöckler, was können Sie als Stadtarchivar über die letzte gerichtlich veranlasste Hinrichtung in Konstanz sagen?
Die Frage muss ich an Sie zurückgeben. Meinen Sie in Anspielung auf den ausgegrabenen Galgen bei Allensbach die letzte öffentliche Hinrichtung in Konstanz in der reichsstädtischen Zeit vor 1806?
Gab es denn auch danach noch Hinrichtungen in Konstanz?
Ja sicherlich. Aber beginnen wir mit der letzten öffentlichen Hinrichtung in Konstanz. Sie lässt sich auf den 23. September 1774 datieren. Es war eine Enthauptung. Zuvor hat es zwischen 1570 und 1774 in Konstanz 89 Hinrichtungen gegeben, also etwa alle zwei Jahre eine. Hinrichtungen waren also nicht alltäglich. Anklagegründe waren vor allem Diebstahl, aber auch Mord, Hexerei, Unzucht, Falschschwören und Fluchen.
Und wer war dieser letzte Unglückliche?
Bei der Verurteilten handelte sich um eine Frau: die 42-jährige, ledige Anna Maria Häberlin. Sie stammte aus Mauren im Thurgau, heute eine Ortschaft der Gemeinde Berg im Bezirk Weinfelden. Der Grund für ihre Hinrichtung lautete „Dieberei“. Sie hatte 74 Gulden gestohlen und war schon sechsmal vorbestraft. Da sie noch im Gefängnis zum Katholizismus übertrat, wurden ihre sterblichen Überreste nach der Hinrichtung auf dem Schottenfriedhof beigesetzt. Der wurde bis zur Eröffnung des heutigen Hauptfriedhofs am 1. Mai 1870 genutzt. Ihre Knochen könnten also bei den Arbeiten am Neubauprojekt „Laubenhof“ auf dem Areal des ehemaligen Vincentius-Krankenhauses ausgegraben worden sein.
Wie verbrachte sie ihre letzten Stunden?
Die Verurteilten wurden nach einem Prozess, der oft auch Folter einschloss, zur Richtstätte geführt. Dieser „letzte Gang“ führte vom Blutgericht am Obermarkt durch das Schnetztor, auf dem den ganzen Tag das sogenannte Arme-Sünder-Glöcklein läutete, ins Tägermoos. Dort fanden die Hinrichtungen in der Frühen Neuzeit statt – auch im Fall der Anna Maria Häberlin. Die Strafe wurde ab Mitte des 18. Jahrhunderts durch einen Scharfrichter auf einem erhöhten, rund 50 Quadratmeter großen „Blutgerüst“ vollzogen – und zwar unter den Augen von hunderten von Schaulustigen. Eine öffentliche Hinrichtung war damals noch ein Massenereignis.

Und so erging es auch Anna Maria Häberlin?
Ja, auch sie musste diesen Weg gehen. Und er war sicherlich nicht angenehm für sie. Nach vollzogener Hinrichtung erhielt dann der Scharfrichter als Teil seiner Besoldung die Kleidung der Hingerichteten. Doch nicht immer genügte ein Schlag mit dem Richtschwert. Manchmal musste der Scharfrichter unter dem Gejohle der Menge mehrfach ansetzen. Ein drastischer Fall ist für den 16. Februar 1770 überliefert.
Was ist passiert?
Das von der erhöhten hölzernen Hinrichtungsstätte in Strömen fließende Blut des zwanzigjährigen Verurteilten zog eine junge Frau magisch an. Sie ließ sein Blut in einen Becher rinnen und trank es gierig. In abergläubischem Wahn erhoffte sie sich dadurch Heilung von der Fallsucht, also von der Epilepsie.
Und der Ort dieses Schreckens war immer im Tägermoos?
Nein. Dazu muss ich etwas ausholen: Zuvor gab es Richtstätten an der Sandgrube in Kreuzlingen, nämlich den Galgen am „großen Stein“. Eine weitere war am Käsbach oberhalb von Kurzrickenbach. Mit Verlust des Landgerichts im Thurgau Ende des 15. Jahrhunderts musste die Stadt eine neue Hinrichtungsstätte ausweisen. Der Konstanzer Rat ließ dann 1498 im Tägermoos, ganz in der Nähe des Seerheins, einen neuen Galgen errichten, der bis 1833 bestand. Man nannte ihn das „dreibeinige Tier“.
Sie sagten, es habe auch nach 1806 noch Hinrichtungen gegeben. Davon habe ich noch nie etwas gehört.
Die nach 1806 vollzogenen Hinrichtungen waren eben nicht öffentlich. Deshalb haben sie sich nicht ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Anwesend waren nur bestimmte Honoratioren der Stadt, ein Arzt und ein Priester. Zudem brach ein Staatsanwalt den Stab über dem Verurteilten – die Herkunft der heutigen Redewendung.
Und wann wurde dann das letzte Todesurteil vollstreckt?
Im 19. und 20. Jahrhundert gab es – nach jetzigem Forschungsstand – mindestens sechs Hinrichtungen. Sie wurden im Hof des Amtsgefängnisses in der Wallgutstraße vorgenommen. Wahrscheinlich waren es aber noch mehr. Die letzte gerichtlich angeordnete Hinrichtung fand am 20. Januar 1921 statt. Damals wurde der Raubmörder Max Klinke durch den Scharfrichter Karl Burkhard mittels der einzigen badischen Guillotine zu Tode gebracht. Die Tötungsmaschine, die extra für die Hinrichtung aus Bruchsal nach Konstanz transportiert worden war, befindet sich heute als Nachbau im Städtischen Museum im Schloss Bruchsal.
Ging es mit der Guillotine denn weniger brutal zu als bei früheren Hinrichtungen?
Nein, das Guillotinieren war alles andere als human. Wir wissen etwa, dass es bei der Hinrichtung des Mörders Albert Ebner am 26. August 1891 um 6 Uhr morgens zu einer gravierenden Panne gekommen war. Der Henker Benjamin Burkhard, Vorgänger und Onkel des oben genannten Karl Burkhard, und seine zwei Gehilfen hatten den Verurteilten auf der Guillotine fixiert. Doch es gelang ihm, die Hände frei zu bekommen und sich am Anschnallbrett festzuklammern.
Und dann?
Als das Brett nach vorne geschoben werden sollte, schrie Ebner vor Schmerzen auf. Das Anschnallbrett ging daher nicht weit genug nach vorne. Deshalb traf das Fallbeil nicht wie geplant den Hals, sondern den Schädel. Die grausame Panne führte man danach auf die Aufregung der beiden Gehilfen zurück. Immerhin war der Gefängnishof durch Tücher gegen neugierige Blicke geschützt. Doch wenn es noch eines weiteren Beweises für die Unmenschlichkeit der Todesstrafe bedürfte, wäre das hier ein geeigneter Fall aus Konstanz.