Bei der Ausrufung des Klimanotstands übernahm Konstanz die Rolle des bundesweiten Spitzenreiters unter den Kommunen, bei einigen Stadträten sorgt der heißblütige Vorstoß im Jahr 2019 inzwischen aber für kalte Füße.
Die von der Stadtverwaltung mit Verweis auf die damals medienwirksam inszenierte Aktion begründete Teilnahme an einem Wettbewerb, bei dem sich Konstanz als Modellprojekt „Smart Cities“ anempfiehlt, stößt jedenfalls auf einige Skepsis. Zwar gab es im Rat mit 29 Befürwortern (bei vier Gegenstimmen und sechs Enthaltungen) formal eine breite Zustimmung zur Teilnahme an dem Wettbewerb, die Wortbeiträge verdeutlichten jedoch, dass etlichen Stadträten nicht ganz wohl bei der Sache ist.

Der Grund sind die Kosten. Für das Modell wird ein Finanzvolumen von 17,5 Millionen Euro veranschlagt, wobei der Löwenanteil mit 65 Prozent aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt wird. Die Quote kann sich sehen lassen, allerdings verbleiben 6,125 Millionen Euro bei der Stadt – und für diesen Preis hätte man doch gern etwas mehr als die Katze im Sack.
Quer durch die Fraktionen störten sich die Stadträte vor allem an der wenig konkreten Terminologie der Bewerbung. Beispiel: Bei einem als „Innenstadt-Pilot“ bezeichneten Projekt-Modul geht es um die „Konzeption und räumliche Sicherung eines Ausprobierraums für digitale Experimente und als Schaufenster für städtische Anwendungen“.
Wer sich darunter nichts vorstellen kann, wird im nächsten Satz wie folgt aufgeklärt: Es gehe um die „Weiterentwicklung zum InnenSTADTlabor in ko-kreativem Prozess mit lokalen Akteuren durch hybride Event-Formate (Popup-Kultur)“.
Ein Projekt voller unverständlicher Worthülsen?
Nach Angaben der Stadtverwaltung bedarf es solcher Formulierungen, wenn man beim bundesweiten Wettbewerb mithalten will. Oberbürgermeister Uli Burchardt rechtfertigte dabei die Schwäche der Aussagen damit, dass „wir nicht wissen, wie Klimaneutralität geht“.
Fest stehe unterdessen, dass es Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung nicht gebe. Eben deshalb stehe er hinter der Idee eines Modellprojekts, für das die Stadt Konstanz im Zusammenspiel mit seinen sonstigen Aktivitäten zum Klimaschutz gute Voraussetzungen mitbringe.
Den Ausschlag gab letztlich die erkennbare Absicht des Vorhabens, was nach Einschätzung von Jan Welsch (SPD) jedoch nichts an der Mischung aus „Unverständlichkeit“ und „Worthülsen“ ändert.

Ähnlich fiel das Urteil von Roger Tscheulin aus, der CDU-Sprecher prophezeite „bei dieser Sprache ein schon von Beginn an feststehendes Scheitern“.
Susanne Heiß (Freie Wähler) sprach von der Produktion eines Wasserkopfes und schloss sich im Grundsatz der Meinung von Anke Schwede an: Die Stadträtin der Linken Liste Konstanz bezeichnete das Projekt als überflüssig und plädierte stattdessen für handfeste Projekte für den Klimaschutz.
Funktionieren die „schönen Begriffe“ im Alltag?
Deutlich von Skepsis geprägt war auch die Einschätzung von Nina Röckelein. Die Vertreterin der Freien Grünen Liste (FGL) meinte, dass die „Herausforderungen richtig identifiziert“ worden seien, sie bezweifelt jedoch, dass „die schönen Begriffe im Alltag funktionieren“. Statt einer Projektgruppe mit 5,7 Stellen wäre ihr sehr viel wohler, wenn verwaltungsintern Kompetenzen aufgebaut würden.
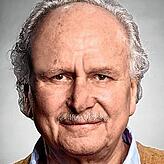
Das wiederum wird in den Fachbereichen des Rathauses genauso gesehen: Mit dem Modellprojekt soll ein übergreifender Prozess für die klimapolitischen Ziele in Gang gesetzt werden.






