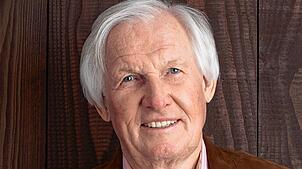Wer eine Wohnung besitzt, muss sie auch zur Verfügung stellen: Dabei bleibt es in Konstanz. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Zweckentfremdungssatzung nicht Mitte März ausläuft, sondern bis 13. März 2030 verlängert wird. Und was beim ersten Beschluss in der Sache im Jahr 2015 noch kontrovers diskutiert wurde, scheint inzwischen auch bei den damaligen Kritikern im bürgerlichen Lager angenommen zu werden: Der Druck auf Immobilieneigentümer bleibt also hoch.
235 Wohneinheiten wurden laut Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn bisher durch die neue Regelung dem Markt zugeführt. Das bezieht sich auf die gesamten zehn Jahre, seit denen die Satzung greift. Zum Vergleich: In Konstanz wurden im Jahr 2022 laut der Wobak 324 Wohnungen neu gebaut. Und auch eine andere Summe gilt der Verwaltung als Erfolgsbeweis: Bei durchschnittlicher Größe und Preisen hätte es etwa 82 Millionen Euro gekostet, diese 235 Wohnungen neu zu errichten.

OB fordert mehr Förderung vor allem vom Bund
Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt findet, das Instrument habe sich für Konstanz bewährt – doch er appelliert auch an Land und Bund, mehr Verantwortung für die Lösung der Wohnungsnot zu übernehmen. Aus dem Bestand heraus könne eine Stadt wie Konstanz das Problem nicht lösen. Trotz aller Versuche, jeden Quadratmeter vorhandenen Wohnraum zu nutzen, brauche es wieder eine beherzte Förderung für den Neubau bezahlbarer Wohnungen.
Klar ist aber auch – es gibt nach wie vor Fälle, in denen das Zweckentfremdungsverbot nicht greift. Da gibt es Immobilien, die schon vor dem 31. Mai 1990 leergestanden haben, und bei denen der Stadt aufgrund der Landesgesetze die Hände gebunden sind.
Eine Statistik der Verwaltung zeigt außerdem: 1128 Verfahren hat sie seit Erlass der Satzung vor knapp zehn Jahren geführt, und 80 Prozent der Fälle führten sie nicht dazu, dass eine weitere Wohnung auf den Markt kam. Ein Grund dafür ist die hohe Zahl an Ferienwohnungen. Allein 378 Mal haben Vermieter die seit 2022 vorgeschriebene Registrierungsnummer beantragt und diese in fast allen Fällen auch erhalten.
Böser Verdacht: Werden Wohnungen illegal über Airbnb vermietet?
Hier setzt auch Kritik aus der Politik an. Anne Mühlhäußer (FGL&Grüne) fordert, dass die Stadt genauer hinschaut, wie oft Vermieter lieber über Airbnb und andere Plattformen an Touristen vergeben, statt dauerhaft Wohnung für Konstanzer zu schaffen. Die Stadtverwaltung, so Mühlhäußer, solle dem Beispiel anderer Kommunen folgen, die Airbnb bereits erfolgreich gezwungen haben, eine Liste mit allen angebotenen Objekten herauszugeben. Nicht nur ihre Vermutung ist: Da gibt es eine große Dunkelziffer.
Jürgen Ruff, Stadtrat der SPD, sieht es ähnlich. Und er spricht einen Punkt an, der gerade bei den bürgerlichen Gruppierungen zunächst für große Bedenken und landesweit sogar für Vergleiche mit der Bespitzelung durch die Stasi in der DDR gesorgt hatte: Es solle der Öffentlichkeit weiterhin klargemacht werden, dass nicht oder nicht korrekt genutzte Wohnungen auch tatsächlich bei der Stadt gemeldet würden. Auch der Deutsche Mieterbund habe durchaus den Eindruck, dass bisher noch nicht alle leerstehenden oder als Ferienwohnung genutzten Wohnungen erfasst seien.

Auch die Altfälle – besonders prominent ist eine seit Jahrzehnten leerstehende Villa in der Neuhauser Straße im Musikerviertel – dürften nicht ignoriert werden, sagt Holger Reile, Stadtrat der Linken Liste. Dass man manchen der Immobilieneigentümer offenbar nicht beikommen könne, sei ein echter Mangel. Es habe sich aber gezeigt, dass die einst mit nur knapper Mehrheit beschlossene Satzung ein funktionierendes Instrument sei.
Wer Wohnungen umwandeln will, kann auch Ausgleich schaffen
Bekannt gemacht wird die Verlängerung der Satzung in den nächsten Tagen – für alle, die eine Wohnung leerstehen lassen, ist damit klar, dass die Verwaltung auch weiterhin ein genaues Auge auf sie haben wird. Wenn sie aber einen Antrag stellen, eine Wohnung nicht „überwiegend anderen als Wohnzwecken zuzuführen“, wie es in der Satzung wörtlich heißt, haben sie durchaus auch Chancen, damit durchzukommen. Dies gilt vor allem dann, wenn sie nachweisen können, dass sie an anderer Stelle einen Ausgleich schaffen, zum Beispiel durch die Schaffung von Ersatzwohnraum.