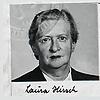Wieder aufkeimender Rechtsradikalismus und Rassismus machen deutlich, warum die Auseinandersetzung mit der Geschichte wichtig ist und warum es des Nachdenkens, Hinterfragens und der Zivilcourage bedarf. Auf das Warum weist die Initiative „Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz“ anhand der Lebensgeschichten verschiedener Personen hin.

Insgesamt 14 Stolpersteine wurden am Freitag, 25. September, in Konstanz verlegt. Zum Beispiel für Louis Übrig in der Kanzleistraße 7, für Josef Anselm an der Ecke Bücklestraße/Austraße, für Maria Obergfell im Bärlappweg 7 oder Lothar Frank in der Altmannstraße 4. Jeder Gedankquader trägt einen Namen und hinter jedem Namen steckt das Schicksal eines Menschen, der unter dem NS-Regime leiden musste. Einige Lebensgeschichten sind hier zusammengefasst.
Hüetlinstraße 31: Mathilde Althoff
Friedrichstraße 30: Frieda Hofgärtner
Die beiden Konstanzerinnen galten für die Nationalsozialisten als „nicht lebenswürdig“, weil sie nicht ins Weltbild passten. Sie wurden Opfer der sogenannten Euthanasie. Dieses aus dem Altgriechischen stammende Wort, was so viel bedeutet wie „guter Tod“, missbrauchten die Schergen des Regimes. Mit diesem trügerischen Begriff beschönigten sie ihre Gräueltaten, nämlich jene zu töten, die geistige, seelische oder körperliche Behinderungen aufwiesen.
Mathilde Althoff aus Konstanz hatte eine Gehbehinderung und litt an epileptischen Anfällen. Frieda Hofgärtner erkrankte als Kind an Masern, was vermutlich zu einem Entwicklungsrückstand führte, durch den sie als „schwachsinnig“ abgestempelt wurde. Beide Frauen wurden im September 1940 in die Tötungsanstalt Grafeneck gebracht.
Bodanstraße 33: Rosa und Sally Salomon
Rosa und Sally Salomon waren Konstanzer. Das NS-Regime deportierte die beiden in ein französisches Lager. Nachdem die Nazis den Salomons alles genommen hatten. Tochter und Schwiegersohn sowie Freunde aus der Schweiz verhalfen dem Paar schließlich zur Flucht in die USA. Doch dort gelang der Neustart der Salomons aufgrund mangelnder Englischkenntnisse nicht.
Bodanplatz 10: Alice und Kurt Maier
Der gebürtige Konstanzerin Alice Maier verließ in den 1920ern ihre Heimat, um mit ihrem Ehemann in Pforzheim zu leben. Nach der Scheidung kehrte sie mit Sohn Kurt nach Konstanz zurück. Bald darauf übernahmen die Nazis die Macht
Der Entschluss, mit der Familie nach Südamerika zu gehen, rettete ihr und ihrem Sohn Kurt nach der Machtübernahme der Nazis wahrscheinlich das Leben. Es zog sie aber wieder zurück in die Heimat.
Bodanstraße 17: Laura und Gustav Hirsch
Die Jüdin Laura Hirsch leitete bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten ein Geschäft für Herrenmode an der Marktstätte. Im Herbst 1940 wurde sie nach Frankreich deportiert, wo sie Zwangsarbeit leisten musste. Währenddessen kämpfte ihr in Konstanz geborener Sohn Gustav Leo in einer jüdisch-palästinensischen Einheit an der Seite der Engländer im Zweiten Weltkrieg.
Kreuzlinger Straße 68: Klara und Helene Dukas
Die genauen Todesumstände wurden nicht herausgefunden. Es ist nur bekannt, dass die Schwestern nach Ausschwitz deportiert wurden und ihre Familie auf ein Wiedersehen hoffte, das niemals kam. Wie die Lebensgeschichten von Helene (geb. 20.12.1890) und Klara (geb. 13.4.1882) Dukas bis dato verliefen, konnte gründlich recherchiert werden.