Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs standen die Christen im Hegau vor einem ungewissen Ostersonntag. Die Karwoche fand ihr Ende an jenem 31. März 1945. Nach der Feier des Palmsonntags stand an diesem Tag Karsamstag im Kalender und statt Vorfreude auf österliche Leckereien bestimmte die Angst vor dem nächsten Luftangriff das Leben. „Wenn man Flugzeuge hörte, suchte man Sicherheit im Wald“, erinnert sich Franz Grathwohl an jene Tage, die er als Fünfjähriger erlebte. Die Fürbitten der Menschen in der Stadt und darüber hinaus galten einem baldigen Ende der Schreckenszeit und einem bald wieder üppiger gedeckten Festtagstisch.
Rückblickend ist überliefert, dass nach mehreren verheerenden Bombenangriffen in den Wochen und Monaten zuvor das Osterfest in der Stadt dennoch ruhig verlaufen ist. „Außer an die Sorge als Kind, dass zum eintretenden Kriegsende nichts mehr Schlimmes im Umfeld der Familie passiert, habe ich keine konkrete Erinnerung“, erzählte der inzwischen verstorbene Singener Ehrenbürger Wilhelm Waibel anlässlich des 75. Jahrestages.
Josef Härtenstein habe als strenger Geistlicher in der Josefskirche gewirkt. „Ein Pfarrer, den man im Nachhinein nicht unbedingt als Unterstützer unserer Jugendarbeit bezeichnen kann“, erinnerte sich Waibel an die Spannungen jener Zeit. „Das Ganze endete im offenen Streit mit Versetzung von Vikar Berthold Amann und später auch Härtensteins“, so Waibel.
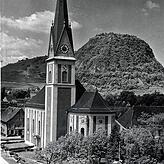
Adolf Engesser war als Pfarrer der Peter-und-Paul-Kirche das geistliche Oberhaupt unter‘m Hohentwiel. Fast ein Jahr war zu diesem Zeitpunkt der einst beliebte Prälat August Ruf bereits tot. Der Singener Ehrenbürger war bei den Nationalsozialisten in Ungnade gefallen, weil er sich als Fluchthelfer engagierte. Er landete im Gefängnis und überlebte die Haftbedingungen nicht. „Ich weiß noch, dass man ihn mit Herr bezeichnete“, erinnert sich Waibel an die Hochachtung, die Singener dem Monsignore entgegenbrachten.

„Er erhob öffentlich die Stimme gegen die Diktatur der Nazis, gegen die Verfolgung der Juden und verweigerte den Hitlergruß“, beschreibt Hans-Peter Storz von der Singener Stolpersteinaktion die Forschungsergebnisse.
Bereits ab 1936 sei er wegen hetzerischen Predigten gegen den nationalsozialistischen Staat von der Gestapo bespitzelt und verwarnt worden. Für die Nationalsozialisten galt er als „Volksschädling“, dem man das Handwerk legen musste. 1941 wurde ihm Schulverbot erteilt, Ende des Jahres trat er gesundheitlich stark geschwächt in den Ruhestand, blieb jedoch in Singen und war auch weiterhin seelsorgerisch tätig.
„Weil Monsignore Ruf einen Amtskollegen, Pfarrer Weiler von Wiechs am Randen, gebeten hatte, Käthe Lasker, einer Jüdin aus Berlin, auf ihrer Flucht in die Schweiz zu helfen ‐ was auch geschah, jedoch der Gestapo bekannt wurde ‐, verurteilte das Amtsgericht Singen August Ruf am 29. Oktober 1943 zu sechs Monaten Gefängnis“, so Storz.
„Dass die Amerikaner schon so nah sind, wussten wir nicht“
Gebhard Reichert, viele Jahre Pfarrer der Singener Herz-Jesu-Kirche, erlebte das Osterfest des letzten Kriegsjahres in ländlicher Ruhe auf dem Hof eines kinderlosen Onkels bei Tauberbischofsheim. „Uns ging‘s gut. Wir waren ja auf dem Dorf“, erinnert er sich an Tage, bei denen Pfirsiche im Feuer süß gegrillt wurden. Doch Krieg hin, Krieg her – am Ostersamstag ging es früh zum österlichen Gottesdienst.
Geahnt, dass der Krieg verloren ist, hat damals auch schon der junge Katholik. „Aber dass die Amerikaner schon so nah sind, wussten wir nicht“, so Reichert. NS-Verantwortliche wussten womöglich schon mehr: „Manch‘ überzeugter Nazi hat sich noch schnell die Absolution beim Pfarrer abgeholt“, erinnert sich Reichert.
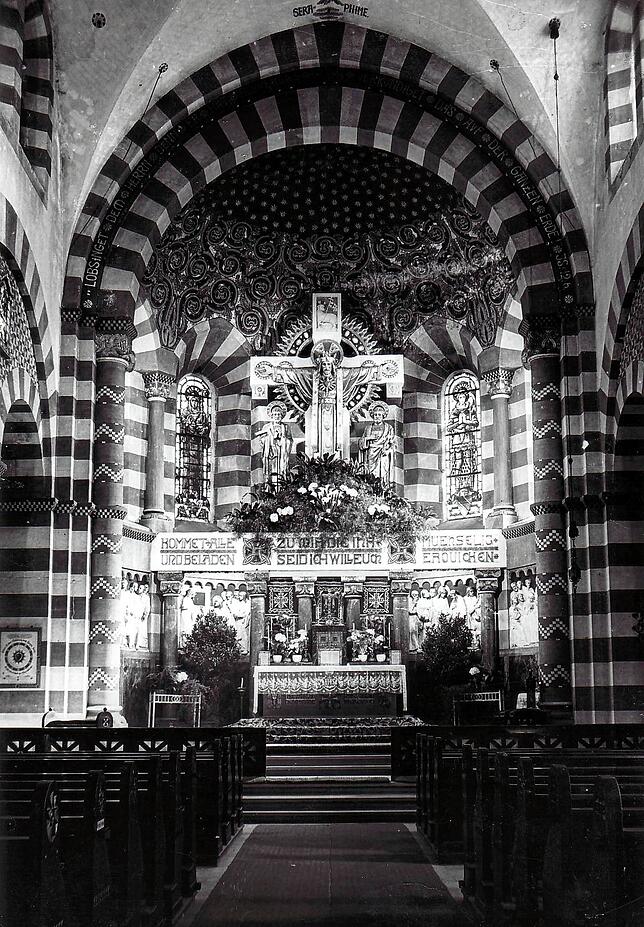
Auch der bereits verstorbene, engagierte Singener Antifaschist Fritz Besnecker erinnert in seiner Lebensbeschreibung an jene Zeit, in der er als junger Mann den Irrsinn des Nationalismus entdeckte. „An einem Tag hat mich mein Vater gebeten, mit ihm und dem Handwagen in Steißlingen den Lohn für seine Arbeit abzuholen“, schreibt er in seiner im Pahl-Rugenstein-Verlag erschienen Autobiografie.
Um die wertvolle Fracht in jenen unsicheren Zeiten sicher nach Hause zu bringen, nutzten sie die Dunkelheit. Trotzdem war es nicht ungefährlich, hochwertige Lebensmittel wie Mehl, Brot, Eier und Speck nach Hause zu bringen. „Hätte uns die Polizei erwischt, wäre mein Vater sicher hart bestraft worden.“

Sorge vor drakonischer Strafe beschreibt auch der Randegger Dieter Fleischmann. Der örtliche Posten habe Waffen im Hauseingang bei Fleischmanns abgestellt: „Dazu gab es die Order, die dort zu lagern – sonst komme ein Erschießungskommando“, erinnert sich der Senior an diese Zeit voller Gefahren in den Jugendjahren.
Der ehemalige Kreisarchivar Franz Götz war zu jener Zeit als 15-Jähriger in Freiburg bei der damals verbotenen katholischen Jugend aktiv. „Seit Dezember hatten wir mit der Gruppe bei Sicherungsarbeiten an dem beim Fliegerangriff auf Freiburg im November beschädigten Münster mitgeholfen. Dort hatten wir auch unter dem südlichen Hahnenturm, zusammen mit französischen Gefangenen, einen Schutzraum erstellt.“

Nicht nur die Kriegsgefangenen hofften auf ein schnelles Kriegsende, sondern auch die vielen Zwangsarbeiter, wie die Singener Partnerschaftsbeauftragte Carmen Scheide erinnert.
Auch Zwangsarbeiter hofften auf schnelles Kriegsende
Gemäß einer Schätzung der Stadtverwaltung arbeiteten bei Maggi 348 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, bei der Alu gar 1195 und bei Georg Fischer über 1600. „Die Zwangsverpflichteten kamen unter anderem aus Polen, Frankreich, Holland und später aus Italien, die größte Gruppe aber bildeten die Verschleppten aus der Sowjetunion“, so Brigitte Matern in einem Artikel der Schweizer Wochenzeitung (WOZ/Nr. 51).
Scheide erinnert an die Geschichte von Sina Darafewa, die im damaligen Aluwerk arbeitete: „Der Krieg nahte seinem Ende, und wie man es ahnte, nicht zugunsten der Deutschen“, beschreibt die Ukrainerin die Lage jener Tage. Man hatte Angst, noch kurz vor Ende des Krieges zu sterben. „Ich weiß nicht mehr genau, aber etwa zur Osterzeit, drei Wochen vor der Befreiung, gingen ich und noch ein Mädchen in ein Dorf in der Nähe von Singen wenn man durch den Wald geht“, beschreibt sie ihre Flucht Richtung Friedingen.
Sie sei bei einem alten Ehepaar auf einem kleinen Hof untergekommen. „Eine Kuh, Ferkel und ein Acker.“ Sie half bei der Feldarbeit und im Haushalt und erfuhr Dankbarkeit: „Als ich in der Küche den eingefressenen, hartnäckigen Schmutz wegputzte, überall sauber machte, bedankte sie die Bäuerin sehr bei mir dafür“, erinnert sich Darafewa, die wie viele junge Frauen, Männer und sogar Kinder in Viehwagen gesperrt und aus ihrer Heimat nach Deutschland verschleppt wurden.
Oft dauerte die Fahrt aus dem Osten zehn Tage und fast immer kamen die Menschen ausgezehrt an. Drei Tage hätten sie nichts zu essen bekommen, berichtet beispielsweise Antonina Danilowna Trinoshenko.
Als der Krieg unübersehbar verloren war, hätten sich die Verhältnisse gebessert: Einige Unternehmer begannen in den Zwangsarbeitern Mitstreiter für ein nichtbolschewistisches Europa zu sehen, wie Matern einen Alu-Betriebsobmann zitiert. In der Maggi sei sogar versucht worden, ukrainische Arbeiter für die Waffen-SS anzuwerben. Ob dies gelungen ist, bleibt im Dunkel der Geschichte, ebenso wie die Diebe, die ein Schwein aus irgendeinem Stall besorgt und geschlachtet hatten.
Osterbraten musste vor Plünderungen gerettet werden
Plünderungen waren an der Tagesordnung und wer etwas Gutes zu essen hatte, wusste, dass er es gut bewachen musste – nicht nur in Industriebetrieben. Auch die Anwohnerschaft – so Matern – musste sich nachts mit Trillerpfeifen und Warndrähten vor unerbetenen Gästen schützen. Nicht, dass der kostspielig ergatterte Osterbraten am Ende in einem fremden Kochtopf landete.
Dieser Artikel erschien erstmals im März 2020.







