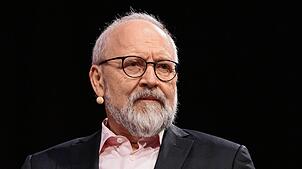Herr Schroeder, was darf Satire?
Satire darf Tucholsky zufolge alles. Und das stimmt. Grenzen sind demnach nur das Grundgesetz und das Strafrecht. Innerhalb dieser Grenzen ist alles erlaubt.
Wo gibt es für Sie persönlich Grenzen des guten Geschmacks?
Ich versuche, keine Witze auf Kosten von Menschen zu machen, die es nicht verdient haben, wie Opfer von Kriegen, Unfällen oder Verbrechen. Ich versuche auch nicht nach unten zu treten. Also keine Gags auf Kosten von Schwachen. Ähnliches gilt für Witze über behinderte Menschen. Und wenn, dann sehr vorsichtig. Das kann man auch stilvoll machen, sodass sie selbst darüber lachen. Mir geht es in der Regel darum, stets dort hinzuschauen, wo Menschen sind, die in irgendeiner Form Macht und dementsprechend selbst eine Sendegewalt haben.
Wenn ich mir Auftritte von Ihnen anschaue, wie beispielsweise den Aschermittwoch 2023, bei dem Sie Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer als Unruhestifter bezeichnen, wofür Sie ebenso Applaus wie Buhrufe ernten, habe ich den Eindruck, Sie lieben es, zu polarisieren, zu provozieren.
Teilweise ja – aber genau dieser Auftritt war von mir gar nicht als Provokation gedacht und ich war selbst überrascht, welche Reaktion es daraufhin gab. Gleichzeitig empfand ich die geteilte – und teils heftige – Publikumsreaktion als Auszeichnung, nicht nur für mich als Künstler. Sondern auch für das Publikum, das damit gezeigt hat, dass es lebendig zugeht, dass es vielleicht zu anderen Einschätzungen kommt als ich. Ich mache meinen Job nicht nur für den Gesinnungsapplaus, sondern um Menschen aus ihren Selbstverständnissen und Denkstrukturen herauszuholen – und das mit Humor.
Als Speaker halten Sie Vorträge über Themen wie Meinungsfreiheit und Kommunikation. Wie hat sich denn Ihrer Meinung nach die Art der Kommunikation – gerade in Hinblick auf das Internet – in den letzten Jahren verändert?
Die Kommunikation im Internet hat sich sicher verschärft, das Debattenklima ist härter geworden. Es ist eine gewisse Militarisierung der Gespräche zu beobachten, weil es mittlerweile mehr Sender als Empfänger gibt. Jeder kann potenziell senden und das geht mit einer wahren Explosion von Meinungen einher. Und der Logik der Algorithmen entsprechend, kommt diejenige Meinung am weitesten, die besonders zugespitzt und radikal ist.
Wenn ich dem andauernd ausgesetzt bin, sehe ich mich möglicherweise aufgefordert, ebenso radikal zu antworten. Umgekehrt empfinde ich eine sinkende Toleranz auch bei gemäßigten Menschen, die sich nicht dem radikalen Spektrum zurechnen. Ich nehme dort einen Wunsch nach Lagerfeueratmosphäre wahr.
„Schluss jetzt! – Der satirische Jahresrückblick“, so heißt Ihr neues Programm, mit dem Sie am 12. Dezember wieder in der Singener Gems zu Gast sein werden. Ihren Rückblick gibt es seit dem Jahr 2019. Was ist Ihnen für Ihr Programm wichtig?
Es geht für mich nicht nur um politische Schwerpunkte, wie die Wiederwahl von Donald Trump oder das Aus der Ampelkoalition, sondern ich räume ein weites Feld ab, wie beispielsweise das Comeback von Stefan Raab oder das Buch von Thomas Gottschalk. Alles ist dabei. Wichtig ist: Das Ganze soll kurios bleiben, daher nehme ich auch Themen aus dem Boulevardbereich und dem Alltag. Diese sind im Prinzip ähnlich wertvoll wie die politischen, denn sie lehren viel über den Zustand des aktuellen Zeitgeschehens.
Ein ganzes Jahr in ein zweistündiges Programm zu packen, ist nicht leicht. Was waren denn für Sie persönlich die aufsehenerregendsten Ereignisse des Jahres 2024?
Ich finde, dass es im Zuge des Israel-Gaza-Krieges eine Zunahme von Antisemitismus gibt, der völlig untergeht, gerade im Kulturbetrieb. Schauen Sie sich nur den diesjährigen ESC an, wo die israelische Kandidatin Eden Golan nur unter Buhrufen auftreten und nur unter Polizeischutz das Hotel verlassen konnte. Egal, ob im Theater oder in der Bildenden Kunst: Man ergeht sich in Relativierungen und Ausreden. Man kann sagen: In der Kultur ist Antisemitismus Punk geworden – ein Akt der Rebellion. Am anderen Ende des Spektrums ist Rassismus Pop geworden – das haben wir nach dem „Deutschland den Deutschen“ grölenden Jungen und Mädchen auf Sylt gesehen. Beides gehört zusammen.
Lassen Sie uns nach vorn schauen. Das Programm, mit dem Sie im Jahr 2025 auf Tour gehen werden, heißt „Endlich glücklich“. Was macht Sie denn glücklich?
Es gibt ganz vieles, was mich glücklich macht. Vor allem Eskapismus, raus aus allem, rein ins Nichts. Privat bin ich permanent auf einem Yoga Retreat auf Hawaii und lasse mich von Schamanen dazu bringen, dass ich noch gelassener werde. (Lacht) Nein, es geht um die aktuelle Glücksüberladung, das Glück als Diktatur, die wir überall erleben. Damit beschäftige ich mich in meinem neuen Programm.
Sie leben schon lange in Berlin, kommen gebürtig aus Lörrach. Außerdem waren Sie schon ein paar Mal in der Singener Gems zu Gast. Haben Sie einen Bezug zu der Bodenseeregion?
In der Tat mag ich den Bodensee – je älter ich werde – immer mehr. Das sagt allerdings viel mehr über mich aus als über den Bodensee, denn wenn man älter wird, lernt man Teile seiner Herkunft immer mehr zu schätzen. Als Jugendlicher fühlt man sich hingegen fast schon dazu verpflichtet, solche heimatnahen Ausflüge abzulehnen und zu sagen: Ich will lieber an den Lake Michigan – um, dort angekommen, dann festzustellen, dass der Bodensee mindestens genauso schön ist.