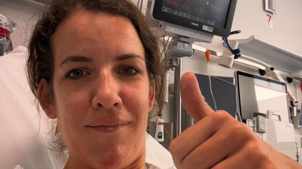Wer schon einmal auf Wohnungssuche war, der weiß: Das kann nervenaufreibend sein. Entweder entspricht das Objekt nicht den eigenen Wünschen, es ist zu teuer oder es fehlt an Angeboten. Auch in Singen ist Wohnraum rar. Die Stadt arbeitet zwar an Neubauten, aktuell etwa mit dem Scheffelareal, doch bis diese bezugsfertig sind, dauert es. Dabei könnte es einfache Lösungen geben, findet Christian Siebold, Vorstandsvorsitzender des Verbands Wohneigentum Siedlergemeinschaft Singen.
Im März hat der Bundesverband Wohneigentum eine Online-Umfrage zu den Themen Wohnungsmangel und ungenutzter Wohnraum gemacht. Schlagwörter hierbei waren teilen, umbauen und vermieten. Die Befragung wurde auch von der Singener Siedlergemeinschaft unterstützt. „Diese Themen finden kommunalpolitisch zu wenig Beachtung“, sagt Vorstandsvorsitzender Christian Siebold. Er wünscht sich, dass auch in Singen mehr darauf eingegangen werde.
Neubauten sind kein Allheilmittel
Laut Siebold seien Neubauten zwar durchaus ein gutes Mittel, um neuen Wohnraum zu schaffen. Aber das sei nicht nur teuer, sondern auch ein langfristiger Prozess. „Neubauten sind kein Allheilmittel“, findet Siebold. Viel effizienter sei es, den ungenutzten Wohnraum wieder attraktiv zu machen.
„Wenn man sich in der Stadt umschaut, dann findet man viele Leerstände.“ Als Beispiel führt er die Rielasinger Straße in der Südstadt an. Dort würden einige Häuser seit geraumer Zeit brach liegen. „Dabei könnte man diese Leerstände mit wenig Aufwand wieder dem Wohnungsmarkt zuführen“, ist er überzeugt. Nach einem ähnlichen Prinzip ist aus dem Pfarrhaus der Markuskirche nun Wohnraum für einige Menschen geworden.
Wohnen gegen Hilfe ist in Konstanz erprobt
Doch auch das Thema alternative Wohnformen bewegen nicht nur den Bundesverband Wohneigentum, sondern auch die Siedlergemeinschaft. In einigen Städten habe sich das Programm „Wohnen gegen Hilfe“ erfolgreich durchgesetzt. Nach diesem Prinzip unterstützen Mieter ihren Vermieter im Alltag und sparen so einen Teil der Miete ein. Auch das Seezeit Studierendenwerk Bodensee in Konstanz unterstützt diese Wohnform.
„Das kann etwa für ältere Menschen interessant sein, die noch im Familienheim wohnen, die Kinder aber längst ausgezogen sind“, sagt Christian Siebold. Das Haus sei in vielen Fällen viel zu groß für ein Ehepaar, und viele Räume ungenutzt. „Warum also nicht ein paar Zimmer untervermieten?“, fragt Siebold.
Nach diesem Prinzip funktioniere auch der Wohnungstausch. Hier gehe es darum, das Haus oder die große Wohnung mit jemandem zu tauschen, der in einer kleinen Wohnung lebt, aber in eine größere Bleibe ziehen möchte – beispielsweise weil sich Nachwuchs ankündigt. Ein weiteres Thema, was nach Sicht des Verbandes zu wenig angegangen werde, ist betreutes Wohnen. Zwölf betreute Wohnanlagen gibt es laut Singener Seniorenbüro. „Hier steckt viel Potenzial drin, das Angebot ist ausbaufähig“, sagt der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft.
Mehr Menschen fordern immer mehr Platz
Siebold ist klar, dass das alles noch Zukunftsmusik ist. „Ich bin mir bewusst, dass andere Wohnformen befremdlich sein können. Aber wir und die Politik müssen uns mit Alternativen auseinandersetzen. Denn die Bevölkerung wächst und die Menschen werden älter. Die Situation wird sich nicht entspannen“, ist Christian Siebold überzeugt. Laut dem Landratsamt Konstanz sind 20,6 Prozent der Bevölkerung 65 Jahre oder älter.
Dazu kommt, dass der einzelne Mensch immer mehr Platz zum Wohnen nutzt. Das konstatiert zum Beispiel die Architektenkammer Baden-Württemberg: Die Zahl der Wohnungen in Deutschland wächst schneller als die Zahl der Einwohner. Verglichen mit 2011 gab es 2020 laut Architektenkammer 6,5 Prozent mehr Wohnfläche. Im selben Zeitraum sei die Bevölkerung um 3,5 Prozent gewachsen. Das heißt: Der Konsum von Wohnfläche pro Einwohner steige kontinuierlich.
Seit den 1990er-Jahren sei der Konsum von Wohnfläche um mehr als zehn Quadratmeter auf 47,4 Quadratmeter im Jahr 2020 gestiegen. Prognosen gehen von bis zu 60 Quadratmeter pro Kopf im Jahr 2050 aus.
Je älter, desto größer die Wohnung?
Diese Entwicklung werde sich mit dem demografischen Wandel fortsetzen: Im Alterssegment über 70 Jahren steige die Pro-Kopf-Wohnfläche auf über 70 Quadratmeter, so die Architektenkammer. Ältere Menschen wollen oder können ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen, zum Beispiel weil sie die Suche und Umzug überfordern oder sie emotional stark verbunden sind, lautet die Begründung.
In Siebolds Augen würden daher andere Wohnformen den Markt zumindest ein wenig entlasten. Er fordert für Singen klar: „Wir müssen etwas tun. Jetzt.“