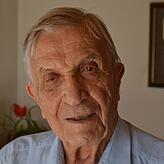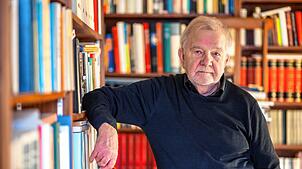Der 28. Mai 1976 war für Meßkirch und die Bürger der Stadt ein besonderer Tag: Um 14 Uhr gab es die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung des in Freiburg verstorbenen Ehrenbürgers Martin Heidegger auf dem städtischen Friedhof, um 17 Uhr die Ernennung des am 31. März 1906 in Meßkirch geborenen Bernhard Welte zum neuen Ehrenbürger der Stadt. Dass die beiden Ereignisse auf denselben Tag fielen, war Zufall. Bei der Trauerfeier auf dem Friedhof in Anwesenheit Hunderter Wissenschaftler, Schriftsteller und Künstler aus dem In- und Ausland
übernahm Heideggers Neffe Heinrich die liturgischen Teile, Sohn Hermann zitierte die von seinem Vater ausgewählten Hölderlinverse, Bernhard Welte hielt die Grabrede.
Heidegger, Sohn eines Küfers und dazu Mesners von St. Martin und von Johanna Kempf aus Göggingen, emanzipierte sich immer mehr vom süddeutschen katholischen Kleinstadtmilieu: Nach dem Besuch der Meßkircher Schulen und des Konstanzer Heinrich-Suso-Gymnasiums legte er in Freiburg das Abitur ab. 1917 heiratet er, sehr zum Missfallen seiner Eltern, die protestantische Offizierstochter Elfride Petri aus Sachsen. Und 1920 verlässt er, der ursprünglich Priester werden wollte, wieder zum Bedauern der Eltern, schließlich das, wie er sich ausdrückt, „System des Katholizismus“.
Nach zwei wegen Herzattacken abgebrochenen Versuchen, ins Jesuitenkloster in Feldkirch einzutreten, wendet sich Heidegger den Naturwissenschaften und schließlich der Philosophie zu. Ab 1919 ist er (als Nachfolger von Edith Stein) Assistent des führenden Phänomenologen Edmund Husserl, ab 1923 Professor in Marburg, ab 1928 in Freiburg. 1927 bricht Heidegger mit dem ersten Band seines (unvollendeten) Hauptwerks „Sein und Zeit“ wie ein Sturmwind in den konventionellen akademischen Betrieb und Sprachgebrauch ein.
Seine Kritik der abendländischen Philosophie („Heidegger – der Alleszermalmer“), sein Rückgriff auf die Grund-Frage der Vorsokratiker („Warum ist eigentlich Seiendes, und warum ist nicht vielmehr Nichts?“) und die denkerische Grundlegung für ein neues Welt-, Natur- und Technikverständnis („in der Welt wohnen, sie aber schonen“) machen ihn über Nacht zu einer europäischen Berühmtheit.
Immer wieder kehrt er in seine Heimatstadt zurück, wo sein Bruder Fritz Martin Heideggers handgeschriebene Manuskripte mit der Schreibmaschine abschreibt. Heidegger wird von Bürgermeister Siegfried Schühle eingeladen, in seiner Geburtsstadt das Wort zu ergreifen. In der Festschrift zum 100. Todestag von Conradin Kreutzer erscheint 1949 erstmals der bekannte Text „Der Feldweg“ mit Heideggers Dank an die Heimat. Seine Rede zur Feier von Kreutzers 175. Geburtstags am 30. Oktober 1955 gehört unter dem Titel „Gelassenheit“ heute zu den bekanntesten seiner Texte.
Auch anlässlich seiner Ernennung zum Ehrenbürger an seinem 70. Geburtstag am 26. September 1959, mit seiner Ansprache zum Schultreffen am 2./3. Mai 1964 (die er mit einem Zitat des ehemaligen Meßkircher Schülers Abraham a Sancta Clara eröffnet: „Nicht alles hat Stroh im Kopf, was unter einem Strohdach geboren ist“) und zur Einweihung des Gymnasiums am 14. Juli 1973 steuert er Beiträge bei. Der Straßenname „Am Feldweg“ und die Heideggerbank am Bichtlinger Sträßle, das „Martin-Heidegger-Gymnasium“ und das „Heidegger-Museum“ halten die Erinnerung an den „Zauberer von Meßkirch“ wach.

Nach dem Besuch der Meßkircher Schulen war Bernhard Welte, wie Heidegger vor ihm, Schüler am Konstanzer Gymnasium. Nach Theologiestudium in Freiburg und München und Priesterweihe ist er 1934 bis 1948 Sekretär von Erzbischof Conrad Gröber, ab den 40er Jahren Mitglied des „Freiburger Kreises“, in dem Intellektuelle neue Wege des theologischen Denkens über die Enge einer neuscholastischen Theologie hinaus für die Zukunft suchten.
1952 ernennt ihn die Universität Freiburg zum Professor für Grenzfragen und richtet für ihn 1954 einen bisher fehlenden Lehrstuhl für christliche Religionsphilosophie ein. Welte strebt die Synthese von Existenzphilosophie (Heidegger und Jaspers) mit der Metaphysik von Thomas von Aquin an und thematisiert die Spannung zwischen säkularer Welt von heute und überlieferten religiösen Erfahrungen. Bei der Einweihung des Gröber-Denkmals in Meßkirch 1961 hält Welte die Festansprache, bei der Trauerfeier für Martin Heidegger die Grabrede.
Seine Vortragsreisen führten ihn bis nach Südamerika; 1973 ernennt ihn die Universität in Córdoba (Argentinien) zum Ehrendoktor, 1978 wird ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Am 6. September 1983 stirbt er in Freiburg. Die Bernhard-Welte-Gesellschaft vergibt jährlich einen Preis für hervorragende theologische und philosophische Arbeiten.
Die Stadt benannte einen Fußweg nach ihm. Nach dem Abräumen seines Grabs in Freiburg 2008 wurden seine Gebeine auf Initiative der Stadt und der katholischen Pfarrgemeinde nach Meßkirch überführt, zusammen mit dem von ihm entworfenen und von Emil Wachter gestalteten Grabstein (der Künstler hatte bei Welte studiert, bevor er Maler und Bildhauer wurde). Nun hat sich der Kreis geschlossen: Die beiden in Freiburg verstorbenen Meßkircher Philosophen und Ehrenbürger ruhen zwar auf zwei Seiten eines Weges, aber doch als Nachbarn auf dem Meßkircher Friedhof.
Ihre Bilder: Wir suchen Ihre Bilder und Geschichten aus den 70er Jahren. Wie sah das Leben in den Dörfern und Städten damals aus? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsschätze und Fotos und wir begeben uns für Sie auf Spurensuche.
SÜDKURIER Medienhaus, Lokalredaktion Meßkirch, Hauptstraße 23, 88 605 Meßkirch , Tel. 0 75 75/92 11 61 41, E-Mail: messkirch.redaktion@suedkurier.de