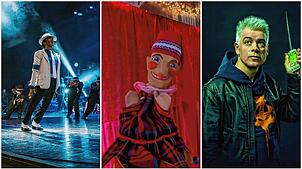Blumberg Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Vorträgen und einer Exkursion nach Hondingen versammelte die inzwischen achte Jahrestagung des Naturschutzgroßprojektes (NGP) am Freitag, 18. Juli Fachpublikum, Politik und Bürger im Haus des Gastes in Achdorf. Das Projekt wird vom Schwarzwald-Baar-Kreis, dem Landkreis Tuttlingen, dem Land Baden-Württemberg sowie dem Programm „Chance.Natur Bundesförderung Naturschutz“ getragen. Projektleiter Thomas Kring sprach über Herausforderungen, Fortschritte und Visionen des seit 2013 laufenden Großprojekts: „Ohne Biotopverbund funktioniert der reine Artenschutz nicht.“ Im Zentrum steht die Stärkung des Biotopverbundes im Landkreis – also die Verbindung einzelner Lebensräume über sogenannte „Trittsteinbiotope“. „Wenn ein Falter einen Lebensraum nicht mehr erreicht, weil der Abstand zu groß ist, muss eine Station dazwischen geschaffen werden“, erklärt Kring. „Wir müssen ermöglichen, dass Arten von A nach B wandern können. Und das ist auf der Baar relativ wichtig, weil wir uns hier an der Schnittstelle zwischen Schwarzwald im Westen und der Schwäbischen Alb im Osten befinden.“ Auf der Baar gebe es viele verschiedene geologische Schichten, aus denen sich unterschiedliche Böden und entsprechend unterschiedliche Biotope entwickelt haben. Und diese Biotope sind zum Teil sehr wichtige Rückzugsräume für Arten, die im Zuge des Klimawandels ausweichen wollen in kühlere Regionen. Das Projekt zeigt bereits Wirkung: ehemalige Tongruben wurden renaturiert, Tümpel wieder angelegt. Dort siedeln wieder vermehrt die Kreuzkröten und auf Magerrasenflächen kehren Kiebitze zurück. Ein wesentlicher Baustein ist die Wiedervernässung von Mooren. Neben der Förderung gefährdeter Arten wie der Bekassine oder dem blauschillernden Feuerfalter tragen diese Maßnahmen auch zur Kohlenstoffbindung bei – ein direkter Beitrag zum Klimaschutz. „Mit unseren Stilllegungsflächen leisten wir mehr als nur Artenschutz“, betont Kring. Insgesamt seien inzwischen 30 Hektar Waldflächen dauerhaft aus der Nutzung genommen worden. Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen und Biolandwirtin, begleitet das Projekt von Beginn an: „Naturschutz und Landwirtschaft sind keine Gegensätze. Wenn man die Landwirte mit ins Boot holt, entstehen tragfähige Lösungen.“ Der Schlüssel sei die sogenannte doppelte Freiwilligkeit: Maßnahmen erfolgen nur, wenn sowohl Eigentümer als auch Pächter zustimmen. Das Modell habe sich bewährt, auch wenn es anfangs Überzeugungsarbeit brauchte. „Heute wissen viele, dass sie Teil eines größeren Ganzen sind“, so Braun. Erfolgreiche Maßnahmen wie die Beweidung mit Wasserbüffeln sollen ausgebaut werden. Auf rund 14 Hektar testet das Projektteam, wie diese Tiere helfen können, Sukzession und Verbuschung zu verhindern – ohne auf schwere Technik zurückzugreifen. „Sie gestalten ihren Lebensraum selbst“, sagt Kring, „und sie hinterlassen Nahrungsquellen für Insekten und Vögel.“ Die finanzielle Basis des Projekts ist solide: 90 Prozent der Kosten werden vom Bund getragen. Die restlichen zehn Prozent teilen sich die beiden Landkreise anteilig, basierend auf der Projektfläche. Für die Zukunft ist aber noch vieles offen. „Bis 2028 muss klar sein, wie es weitergeht“, mahnt Braun. Der Erhalt sei keine einmalige Investition, sondern eine Daueraufgabe. Landschaftspflegeverbände und Förderstrukturen sollen den Übergang sichern. Der NGP-Tag verdeutlichte: Naturschutz funktioniert nicht im Alleingang. Er braucht funktionierende Netzwerke – zwischen Biotopen, aber auch zwischen Menschen. „Wir werben für unsere Arbeit – bei der Bevölkerung und bei der Politik“, sagte Kring. Das Projekt habe bereits vieles erreicht – es liege nun an allen Beteiligten, diesen Weg weiterzugehen.
Blumberg
Zwischen Kreuzkröte und Klimaschutz
- Naturschutz-Konferenz
mit Politikern und Experten - Artenschutz und
Landwirtschaft vereinen