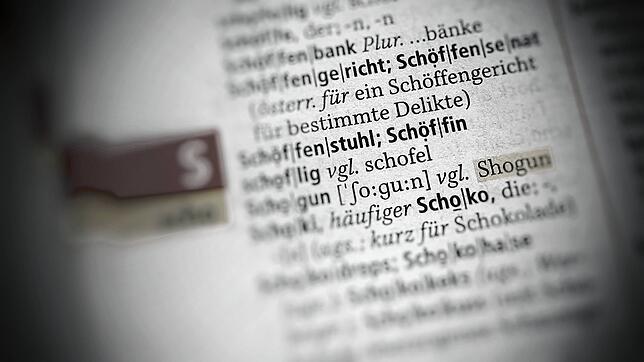Für Athena Grammatikopoulou eröffnen sich am Jugendgericht neue Welten. Nicht unbedingt jene, die sie schon immer einmal kennenlernen wollte. Drogen, Verschuldung, zerrüttete Elternhäuser und in der Folge die kleineren und größeren Straftaten.
Bereits vor fünf Jahren entschied sie für sich, Schöffin werden zu wollen. Nun hat die 50-Jährige ihre zweite Amtszeit angetreten, weil die Erfahrungen der ersten vier Jahre für sie so wichtig waren, dass sie dieses Ehrenamt fortsetzen will.
TV-Gerichtsserie machen sie neugierig
Was sie dazu gebracht hat, in ihrer Freizeit über bisweilen größere, bisweilen kleinere, aber immer junge Gesetzesbrecher zu urteilen, weiß sie heute auch nicht mehr so genau. „Es hat sich interessant angehört“, sagt sie und gibt zu, dass auch die eine oder andere TV-Gerichtsserie ein Grund für die Entscheidung gewesen sein könnte.
Im Gegensatz zum Spektakel US-amerikanischer Justizthriller erlebt sie die Realität im deutschen Jugendschöffengericht freilich ganz anders. „Sehr nüchtern, wenig Show“, sagt sie und lächelt. Sehr schnell lernte sie, dass es nicht unbedingt der großen Schauwerte bedarf, um interessante Einblicke in andere Lebensrealitäten zu erhalten.
Schöffen sind wie Eltern
Im Jugendschöffengericht sitzt sie stets an der Seite eines Berufsrichters, in ihrem Fall ist das Bernhard Lipp, und eines Schöffenkollegen. Immer stehen ein Mann und eine Frau als Schöffen dem Justizprofi zur Seite. „Wir verkörpern die Eltern“, sagt Athena Grammatikopoulou – eine Einschätzung, die der Gesetzgeber bei der Zusammensetzung von Jugendschöffengerichten ausdrücklich so im Blick hatte.
Schöffen müssen keinen juristischen Crashkurs für ihr Amt absolvieren: Für die rechtlichen Aspekte gibt es die Berufsrichter. Vielmehr steckt hinter dem Schöffenmodell die Idee, dass die von ihren Gemeinden benannten Kandidaten und Kandidatinnen spezielle Sachkunden aus anderen Bereichen einbringen oder auch ihre Lebens- und Berufserfahrung einbringen, sodass auch nichtjuristische Wertungen und Überlegungen im Gerichtsverfahren miteinfließen.
Laien sind den Profis gleichwertig
Richter Bernhard Lipp, stellvertretender Direktor des Amtsgericht in Villingen-Schwenningen, stellt klar: „Das sind keine Richter oder Richterinnen zweiter Klasse, sondern gleichberechtigt.“ Er verweist auf Paragraph 30 des Gerichtsverfassungsgesetzes, in dem festgelegt ist, dass die Schöffen während der Hauptverhandlung das Richteramt „in vollem Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie die Richter“ ausüben.

Für Schöffen und Schöffinnen an Jugendgerichten gibt es im übrigen besondere Anforderungen: Neben den formalen Kriterien, die für alle Schöffen gelten, müssen müssen die am Jugendschöffengericht erziehungsbefähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein.
Wie Berufsrichter und Schöffen zusammenarbeiten
Lipp hat die Erfahrung gemacht, dass es der Regel keine krassen Unterschiede zwischen Berufsrichtern und Schöffen bei der Urteilsfindung ergeben. Er führt es darauf zurück, dass beide Seiten auf dem Weg zum Urteil ständig im Austausch seien und so gemeinsam ein Urteil entwickelt werde.
„Die Strafzumessung ist eine Wissenschaft“, sagt Lipp – ein Thema, bei dem er den Rahmen vorgeben muss. Er erlebt die Schöffen als sehr verantwortungsbewusst und weit davon entfernt, Stammtischparolen mit der Forderung nach drakonischen Strafen zu verbreiten.
„Das machen Schöffen nicht“, so seine Erfahrung aus vielen Jahren, in denen er im Jugendschöffengericht den Vorsitz führt.
Ständiger Austausch
Athena Grammatikopoulou, Mutter dreier Kinder, kann diese Einschätzung nur bestätigen. Sie spricht davon, dass der Informationsfluss sehr gut sei. Der Richter nehme sich Zeit, um den juristischen Rahmen vorzugeben, sodass man bei der Einschätzung der Fälle und der Konsequenzen zumeist nicht weit auseinanderliege.
Gleichwohl gibt sie zu, dass sie bisweilen strenger urteilen würde – vor allem wenn sie für einen Termin ausgelost werde, in dem sie auf gute alte Bekannte, die Wiederholungstäter, auf dem Sünderbänklein trifft. Da beschleicht sie öfter mal das Gefühl mit Blick auf die Warnungen beim letzten Termin: „Na, viel gefruchtet hat es nicht.“
Traurige Fälle
Bisweilen würde sie die Jugendlichen aber einfach nur trösten. Sie berichtet von einem bestürzenden Fall, in dem ein Jugendlicher vor Gericht landete, weil er im Internet Kleidung bestellt hatte – wohl wissend, dass er sie niemals bezahlen könne. Normale Ware, nicht teuer, nichts Besonderes.
„Der Junge wollte einfach etwas zum Anziehen haben, weil der Vater nicht für ihn sorgte“, sagt sie. Dass so jemand durchaus empfindlich bestraft werden kann, bedauert sie und findet es gleichzeitig auch gerecht.
Die Tatsache, dass der Junge von Anfang wusste, dass er nicht zahlen konnte, werde ihm juristisch eben negativ ausgelegt – auch wenn die Begleitumstände eher Mitleid erregten. Um die 20 Verhandlungen hat sie während der ersten vier Jahre ihrer Tätigkeit miterlebt, ein zeitlicher Aufwand, den sie für vertretbar hält.
Lerneffekt gleich null
„Sie lernen es einfach nicht“: Mit dieser Erfahrung verlässt Athena Grammatikopoulou immer wieder das Gerichtsgebäude. Alkohol am Steuer, nicht selten ohne Führerschein, sei so ein Delikt, auf das so manche junge Delinquenten ein Abo zu haben scheinen.
„Sie verbauen sich damit die Zukunft“, sagt die Schöffin, doch auch letzte Drohungen führten eben nicht immer zum Erfolg.