Spätestens im Grundschulalter wissen Kinder: Fernsehen und Kino sind nicht die Wirklichkeit. Trotzdem haben Fernsehserien und Kinofilme eine gewisse Wirkung: FBI-Agentin Dana Scully (Gillian Anderson), forensische Medizinerin und weibliche Hauptfigur der Serie „Akte X“, hat in den USA viele junge Frauen dazu animiert, ein MINT-Fach (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) zu studieren.
Um die Geschlechterdarstellung in den Medien erforschen zu lassen, haben die Schauspielerin Maria Furtwängler und ihre Tochter Elisabeth über ihre Stiftung MaLisa eine Untersuchung finanziert.
Das schockierendste Ergebnis der Studie von Elizabeth Prommer und Christine Linke (Institut für Medienforschung an der Universität Rostock) ist die Feststellung, dass sich gerade im fiktionalen Fernsehen seit Jahrzehnten nichts verändert hat. Denn schon 1975 lautete das Fazit einer Analyse: „Männer handeln, Frauen treten auf.“
Dass vielen Menschen prompt diverse Gegenbeispiele einfallen, etwa in Gestalt von Tatort-Kommissarinnen wie Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) oder den Nachrichtenmoderatorinnen Caren Miosga („Tagesthemen“) und Marietta Slomka („heute journal“), liegt an deren Ausnahmestatus.

Für ihre Untersuchung haben Prommer und Linke 3500 Stunden deutsches TV-Material analysiert. Dabei wurden alle sichtbaren Personen sowie die Verantwortlichen (Regie, Drehbuch, Kamera, Redaktion, Produktion) erfasst.
Die wichtigste Erkenntnis: Männer sind im deutschen Fernsehen doppelt so oft vertreten wie Frauen. Die wiederum werden mit zunehmendem Alter praktisch unsichtbar: Ab 30 verschwinden sie sukzessive vom Bildschirm, das gelte für „alle Sender über alle Formate und Genres hinweg“, heißt es.
Keine Chance für 60-Jährige
Ab Mitte 30 beträgt das Verhältnis eins zu zwei, ab 50 eins zu drei, ab 60 eins zu vier. Als Beispiel führen die Autorinnen die ARD-Krimireihe „Donna Leon“ an: Kaum jemand stört sich daran, dass Hauptdarsteller Uwe Kockisch mit 75 im Grunde viel zu alt für die Rolle von Commissario Brunetti ist. Filmpartnerin Julia Jäger, die Brunettis etwa gleichaltrige Ehefrau Paola spielt, ist Ende 40.
Der Fantasie, resümieren die Wissenschaftlerinnen, „scheint in Bezug auf Männer keine Grenze gesetzt zu sein, bei Frauen jedoch schon“.
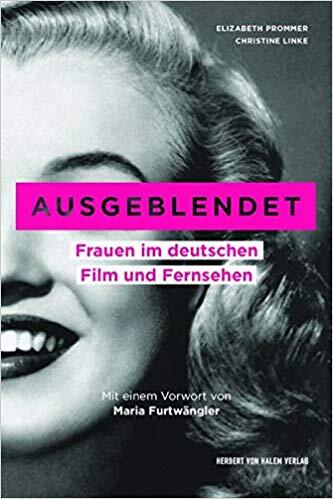
In den Bereichen Show und Unterhaltung ist das Phänomen noch krasser, hier finden sich jenseits der 50 praktisch keine Frauen mehr. In der non-fiktionalen Unterhaltung ist das Missverhältnis ohnehin eklatant (80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen).
Die Gäste aller möglichen Sendungen sind ebenfalls eher männlich als weiblich – das gilt für Shows ebenso wie für Informationssendungen. Gerade hier, monieren Prommer und Linke, könnten Frauen Berufs- und Lebenserfahrung einbringen, aber das werde ihnen selbst in Berufsfeldern wie Bildung verwehrt, in denen sie in der Wirklichkeit die Mehrheit stellen.
Wenn Frauen einfach verschwinden
Auf diese Weise werde „ein veraltetes Bild von Lebenswelten und ein verzerrtes Bilder unserer gesellschaftlichen Realität“ gezeigt. Mit einer Mischung aus Verwunderung und Resignation stellen die Forscherinnen fest: „Es scheint ein Bermudadreieck des Fernsehens zu geben, in dem Frauen ab Mitte 30 offensichtlich ausgeblendet werden.“
Die Misere beginnt im Kinderfernsehen. Hier liegt der Anteil männlicher Protagonisten bei 72 Prozent. Wenn jemand etwa in einem Wissensmagazin die Welt erklärt, dann ist das eher ein Mann als eine Frau. Auf diese Weise werde von Kindesbeinen an ein bestimmtes Weltbild vermittelt: Die „Unsichtbarkeit von Mädchen“ führe zu „eingeschränkten Vorstellungsräumen“.

Das geschlechtliche Missverhältnis kann nach Ansicht der Autorinnen die Ursache dafür sein, dass „so wenig in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit“ passiere: Die Medien lieferten kein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern produzierten und zementierten Rollen- und Geschlechterbilder.
Die Frage, ob es einen „Mechanismus des Ausblendens“ gebe, führt hinter die Kamera, wo ein ähnliches Missverhältnis herrscht. Beim Kinderfernsehen sitzt in 90 Prozent der Produktionen ein Mann auf dem Regiestuhl.
Auch beim Kinofilm sind Frauen in den kreativen Schlüsselpositionen Regie (20 Prozent) und Drehbuch (17 Prozent) in der Unterzahl. Bei TV-Filmen und Serien gab es zum Zeitpunkt der Untersuchung nur 14 Prozent Regisseurinnen.
Mehr frauen hinter die Kamera
Wie wichtig die Besetzung dieser Posten ist, zeigt ein Quervergleich: Sind sie in Männerhand, sind Haupt- und wichtige Nebenrollen eher männlich. Frauen rücken stärker in den Vordergrund, je mehr Frauen hinter der Kamera in Leitungsfunktion agieren. Da Männer offenbar eher Geschichten über Männer erzählen, scheint die Erklärung für die Misere vor der Kamera auf der Hand zu liegen.
Über die Gründe für das Ungleichgewicht hinter der Kamera lässt sich nur mutmaßen. Für eine Branche, die sich als kreativ bezeichne, finden die Forscherinnen die „Geschlechterbilder erschreckend stereotyp, traditionell und wenig fortschrittlich“.





