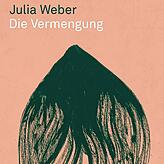Julia Weber schreibt gerade an ihrem zweiten Roman, als sie schwanger wird. Macht doch nichts, wir leben ja in Zeiten der Gleichberechtigung? Von außen mag das so aussehen. Doch für Weber ist an den gerade begonnenen Roman kaum mehr zu denken, ja, das Schreiben selbst steht zur Disposition. Hat sie doch bislang das Private vom Beruflichen sorgsam getrennt, so sorgsam das jedenfalls geht in der Kunst.
Plötzlich fängt alles an, sich miteinander zu vermengen. Und wollte sie weiter schreiben, käme als Thema allenfalls noch genau das infrage: die nur scheinbar selbstverständliche Frage, ob eine gute Mutter zugleich eine gute Künstlerin sein kann. Oder vielmehr: Was es ist, das eine Frau überhaupt auf den Gedanken bringt, Kind und Kunst könnten einander ausschließen.
Es liegt eine Falle in dieser Themenwahl, sie besteht in Faktoren, die zum politischen, mithin unliterarischen Lamentieren verleiten. An vielen Theatern etwa sind Mütter noch immer benachteiligt, zum Beispiel weil sie sich um Kinderbetreuung außerhalb von Kita-Zeiten kümmern müssen oder weil die Schwangerschaftspause ihre Karriere ausbremst.
Eine Dichterin, die ihr öffentliches Nachdenken bei diesen sehr konkreten Problemen ansetzt, tritt von selbst aus der Poesie heraus und mitten aufs Parkett des alltäglichen Streits um Arbeitnehmerrechte, Kindergartenplätze und Familienbesteuerung. Das Ergebnis wäre ein profanes Sachbuch statt Literatur und damit die ungewollte Bestätigung der doch so unbedingt zu verneinenden Ausgangsthese.
Weber macht um diese Falle einen großen Bogen, konstruiert statt der politischen Streitschrift eine kaum zu durchdringende Mischwelt aus realer und fiktiver Welt, aus Roman und Leben, Familie und Politik. Zitate gibt es fast durchgehend nur in indirekter Rede. Ihr Publikum überfordert sie damit von Anfang an, doch es ist eine Überforderung aus gutem Grund – und eine, die sich lohnt.
Da ist zunächst die Autorin selbst, Julia, die sich um Erklärungen bemüht für ihre durch einen positiven Schwangerschaftstest ausgelöste Schaffenskrise. Kompromisse, erkennt sie, vertragen sich nur schlecht mit künstlerischer Tätigkeit. Man muss als Mutter solche Kompromisse eingehen, man muss sich auch zurücknehmen, Verantwortung für einen anderen Menschen übernehmen statt allein für sein Werk. Als Mutter, denkt diese Julia, habe sie sich samt und sonders von jeglicher Komplexität des Seins zu verabschieden: „Nur noch auf dem Spielplatz hinter der Schaukel stehen“ und mit anderen Müttern über „den Durchfall oder Nichtdurchfall meines Kindes“ reden.

Doch die Komplexität des Seins kommt durch die Hintertür zur Wohnung wieder herein, in Gestalt von Linda, in der Person Ruths. Es sind fiktive Figuren mit ganz anderen Zielen, Sehnsüchten, Gedanken. Statt kreativer Not kreisen sie um sexuelle Erfüllung, Selbstbehauptung, Kampf um Liebe. Julia begegnet ihnen, spricht, schreibt mit ihnen. Und lernt dabei allmählich: Diese anderen Frauen sind sie selbst, eine Julia ohne Schwangerschaft, aber mit jenen existenziellen Krisen, aus denen Literatur entsteht. Wie konnte sie nur glauben, solche Figuren müssten verschwinden, sobald in ihrer Schöpferin ein Kind heranwächst?
Die Antwort findet sie im Mutterschaftsbegriff eines Literaturkanons, der von Männern wie Tolstoi geprägt wurde. In dessen Roman „Krieg und Frieden“ ist die Rede vom eben noch blühenden Mädchen Natascha, das nach Geburt ihrer Kinder zu einem „kräftigen, schönen, fruchtbaren Weib“ gereift sei. Die Mutter, das ist im europäischen Literaturkanon ein neuer Mensch, ein Wesen, dem alles Zarte, Fragile, Poetische ein für allemal genommen ist.
„Sie werden jetzt wieder zugemacht“
Julia gleicht diese Vorstellung von zwei verschiedenen Sorten Frau mit ihrem Alltag ab, erzählt von skurrilen Momenten während Schwangerschaft und Geburt. Vom verschwörerisch wissenden Zulächeln der Passanten beim Blick auf ihren runden Bauch bis zu jenem Moment, an dem sie nach vollbrachter Kaiserschnitt-OP zwar ohne Kind aber mit offenem Bauch auf weitere Anweisungen wartet: „Sie werden jetzt wieder zugemacht“, heißt es nur.
Als Schriftstellerin ist sie auf Seelenzustände wie Traurigkeit angewiesen. In ihrer Rolle als Mutter dagegen werden solche Momente verdächtig. Ihr Ehemann will sie unbedingt vertreiben, verspricht Julia eine Massage, eine Reise nach Paris – oder vielleicht tut es auch schon ein schönes Cordon bleu bei einem Glas Wein?
„Wenn jemand keine Traurigkeit kennt“, sagt Julia, „dann hat dieser Mensch nie richtig in die Welt geschaut.“ Es scheint, als dürfe eine Frau nicht mehr richtig in die Welt schauen, sobald sie Mutter ist.
Kunst hört nicht auf, nur weil ein Kind unterwegs ist. Es ist aber möglich, dass ihr Herstellungsprozess schmerzhafter wird: nicht wegen der Künstlerin selbst – sondern wegen der Gesellschaft, in der sie lebt.