Der Mensch, bekannte Friedrich Schiller einmal, sei nur da ganz Mensch, wo er spielt. Tatsächlich hilft das Spiel im Leben über manchen Abgrund hinweg: Theater als therapeutische Maßnahme bei Gewalttraumata, Sport als vorbeugende Konfliktbewältigung. Und auch wer nicht einmal weiß, wer er ist, kann es im Spiel herausfinden.
Die junge Gloria ist so ein Fall. Als Tochter einer alleinstehenden, offenkundig sehr wohlhabenden Hausbewohnerin bleibt ihr die eigene Identität ein Mysterium. Im von starren Konventionen geprägten Vorarlberg der 1960er-Jahre ist das Aufwachsen ohne Vater schon an sich verdächtig. Ihre Mutter erzählt ihr von einem Mann, der aus dem Osten gekommen sei, mal ist es Rumänien, mal Albanien, plötzlich ein Ungar: ein tapferer Antikommunist jedenfalls, von seiner Abenteuerlust weitergetrieben bis nach Amerika. Ahnt Gloria, dass diese Räuberpistole nicht recht stimmen kann?
Hübsch anzuschauen und unermesslich reich
Der liebe Gott hat ihr zwar allerhand Vorteile auf den Lebensweg mitgegeben. Da ist zunächst ihr hübsches Erscheinungsbild, aber natürlich auch der unermessliche Reichtum. Banken mag ihre Mutter das Geld nicht anvertrauen, der Wertverfall der 20er-Jahre dürfte noch zu gut in Erinnerung sein. Also liegen die Scheine gebündelt irgendwo im Haus herum: hinter Schrankwänden, in Kochtöpfen.
Als junge Frau kann man damit eine Menge anstellen, zum Beispiel mit der Schulfreundin Monika für ein paar Tage nach Zürich fahren, in schicken Läden einkaufen und Fotosessions vor geparkten Limousinen veranstalten. Eben diese Freundin Monika wird in vielen Jahrzehnten als erfolgreiche Schriftstellerin ein Buch darüber schreiben (Monika Helfer: „Die Jungfrau“, Hanser-Verlag). Doch eine Heldenrolle bleibt Gloria darin verwehrt. Denn Geld bedeutet zwar viel in den Jahren der Nachkriegszeit. Aber eben nicht alles. Und das, was fehlt, ist das Entscheidende.
Die schöne, reiche Gloria, so erinnert sich die Ich-Erzählerin Monika, habe ständig gespielt. Als sei sie auf der Suche nach ihrer Rolle gewesen. Ihren selbstbezogenen Anwandlungen, dem ständigen „Ich, ich, ich“, widerspreche das keineswegs. Wenn nämlich jemand dauernd „Ich“ sagt, „heißt das nicht unbedingt, dass er daran Gefallen hat, wie er ist“.
Es gibt in unserem heutigen Verständnis der Nachkriegs- und Wirtschaftswunderzeit (auch in Österreich gab es einen rasanten Aufschwung) die verbreitete Vorstellung, äußerliche Werte wie Geld und Schönheit hätten sozialen Aufstieg ermöglicht. Getreu dem Motto: „Hast du was, bist du was!“ In ihrem Roman zeigt Monika Helfer am Beispiel der Jugendfreundin, wir brüchig dieser Mythos ist.

Gloria sucht in Zürcher Bars nach der Liebe, findet aber nur Männer, die ihr beibringen, was das Wort Blowjob bedeutet. Auf der Schauspielschule verliebt sie sich in ihren Professor, beginnt eine Affäre mit ihm. Doch seine Familie für sie verlassen will er nicht. Mehr noch: Nicht einmal Sex ist mit ihm drin. Wegen seines katholischen Glaubens und den damit verbundenen Höllenqualen nach irdischen Sünden.
Es sind aus heutiger Sicht fragwürdige Überzeugungen, denen die Menschen in dieser Gesellschaft folgen. Und doch: Es sind Überzeugungen. Und zwar so starke, dass sogar der Sexualtrieb sich ihnen beugen muss.
Monika Helfer führt uns in eine Zeit, die Prinzipien wie Betonwände zwischen die Menschen stellt. Und wie sie ihre Protagonistin gegen diese Wände anrennen lässt, ist von wunderbar bitterer Komik.
Eine Frau für die großen Gesten
So begleiten wir Gloria beim Versuch, sich am Zürcher Flughafen ein Ticket nach New York zu erwerben – aufreizend geschminkt, mit großer Geste die Scheine auf den Tisch blätternd. Und als der Herr am Schalter sie dennoch auf ihr junges Alter anspricht, fügt sie „wimpernklappernd“ hinzu: „Aber mein Daddy erwartet uns!“
Später, als Schauspielstudentin, wirft sie sich ihrem verheirateten Liebhaber theatralisch vor die Wohnungstür, sodass die nichts ahnende Ehefrau buchstäblich über sie stolpert und sich den Knöchel verstaucht. „Bitte, lassen Sie sich scheiden!“, ruft Gloria ihrer Konkurrentin zu. Sie könne ihr auch viel Geld zahlen!
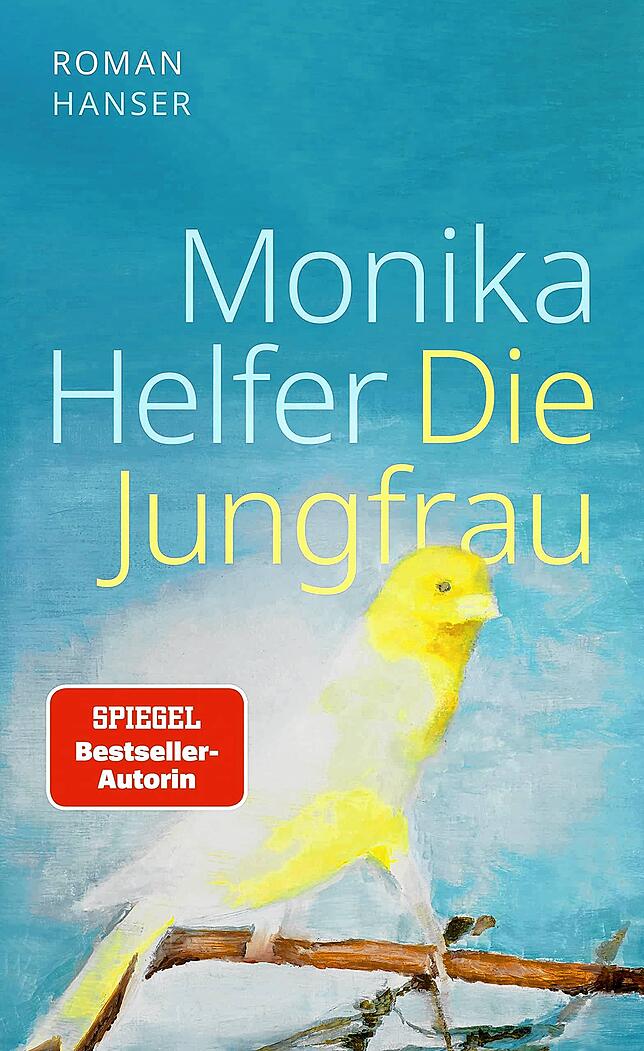
Meisterhaft gelingt es Helfer, den ihrer Figur eigenen tragischen Witz selbst durch den Filter der Ich-Erzählerin noch leuchten zu lassen. Ja, mehr noch, eben diese Ich-Erzählerin entwickelt im Laufe des Romans ihrerseits eine scharfsinnige Ironie. Mit der Erinnerung an gemeinsame Jugendtage ist als zweite Zeitebene nämlich die Gegenwart verwoben. Gloria, inzwischen über 70 Jahre alt, wähnt sich bereits im Sterben, will vorher noch ein letztes Mal ihre alte Freundin sehen.
Eine Nichte vermittelt den Kontakt, erkennbar auch in eigenem Interesse: Im alten Haus soll noch immer Bargeld im Wert von rund 200.000 Euro versteckt sein, da wäre man doch gerne Erbe. Die Besucherin könnte ja – so unter alten Freundinnen – ein gutes Wort für sie einlegen! Entsprechend ergeht sich die Nichte also vor Monika in Eigenlob für aufopferungsvolle Pflege und jahrelange Zuwendung.
„So tarnt sich die Gier“, notiert die Erzählerin trocken. Nämlich gar nicht vor den anderen. Sondern ausschließlich vor den Gierigen selbst.
Wer immer spielt, gibt sich niemals zu erkennen. Sie wolle, raunt die gealterte Gloria ihrer Freundin zu, ein Geheimnis verraten. Dass sie nämlich niemals mit einem Mann geschlafen habe, noch immer Jungfrau sei. Stimmt das? Oder spielt sie es nur?
„Jungfräulichkeit will man, Jungfernschaft stößt einem zu“, sagt Monika an einer Stelle. Enthaltsam leben bis in den Tod: Das lässt sich auch als Protest verstehen. Gegen eine Gesellschaft, die dir außer der Jungfrau keine andere Rolle zugesteht.






