Die Welt steckt in der Trotzphase. Von der Protestwahl über den Zollstreit bis zum Bombenterror: Es gilt das Gesetz des Starrsinns, und niemand weiß so recht, warum eigentlich. Denn messbaren Erfolg bringt dieses Prinzip ja eher selten.
Die österreichische Literaturkritikerin Daniela Strigl hat sich auf die Suche nach den Ursachen begeben. In ihrer „Erkundung einer zwiespältigen Eigenschaft“ (“Zum Trotz“, Residenz Verlag) durchstreift sie die verschiedensten trotzigen Charaktere deutscher Literatur- und Geistesgeschichte.
Dabei wirkt es lange, als bekomme sie aller Lebensklugheit und Lektüreerfahrung – nun ja: zum Trotz – das Thema nicht recht zu fassen. Das Widerständige im menschlichen Wesen hat nun mal viele Gesichter, und nicht immer lässt es sich so leichthin als Ausdruck von mangelnder Reife und fehlendem Verstand abqualifizieren.
Die einzige Stärke des Schwachen
Arthur Schnitzler zum Beispiel würdigte den Trotz als „einzige Stärke des Schwachen“, freilich unter der Einschränkung, dass auch diese Stärke letztlich „eine Schwäche mehr“ sei. Berühmtestes Beispiel dafür ist wohl Michael Kohlhaas, mutiger und zunehmend übermütiger Held aus Heinrich von Kleists gleichnamiger Novelle.
Als dieser seine beiden in staatliche Obhut gegebenen stattlichen Pferde abgemagert und zerschunden zurück erhält, ist er ja durchaus bereit, sich mit der „Gebrechlichkeit der Welt“ abzufinden. Jedenfalls dann, wenn zum Beispiel sein eigener Knecht eine Mitschuld hätte und die zuständigen Instanzen ihm noch ein Mindestmaß an Respekt entgegenbringen.
Zum Trotz führt wohl erstens die Erkenntnis, dass sich im eigenen Fall das Muster eines generellen Staatsversagens zeigt. Zweitens der Umstand, dass statt Respekt dem kleinen Bürger nur Hohn und Spott von den Schlossmauern entgegenschlägt. Trotz lässt sich soweit also als durchaus gesunde Reaktion verstehen, als wertvolles Korrektiv zu staatlicher Willkür und Ignoranz. Das Problem liegt eher in der Maßlosigkeit, dem mangelnden Vermögen, die Gebrechlichkeit nicht nur in der äußeren, sondern auch in der eigenen, inneren Welt zu erkennen.
Indem der Rebell sich selbst zum Herrscher aufschwingt, läuft er auch Gefahr, die Fehler der Mächtigen zu wiederholen. Das unterscheidet ihn vom Typus „Wilderer“, der schon per Definition niemals auf die Seite der Gesetzeshüter wechseln kann und deshalb die besondere Sympathie des Volkes genießt. Wobei diese Sympathie bezeichnender Weise vor allem Stadtbewohner aufbringen: so etwa im Fall des Osttirolers Pius Walder, der 1982 von zwei Revierjägern auf der Flucht erschossen wurde.
Das anachronistisch-romantische Bild vom Wildschütz als Rebell, schreibt Strigl, passe erstaunlich gut in die Medienwelt der Postmoderne. Es gehe um den „archaischen Gegenentwurf zum urban Way of Life, am Nimbus des unbeugsamen Kraftlackels, der sein Leben dem Kampf der Gerechtigkeit verschreibt und den Machtinstanzen der Provinz ebenso trotzt wie dem Zahn der Zeit.“
Unter der Kategorie „Einzelkämpfer“ verbucht Strigl renitente Querköpfe, die das Dagegensein zur „Grundlage ihrer publizistischen Existenz gemacht haben“. Fernsehfiguren wie Jan Böhmermann kommen einem da in den Sinn, Strigl aber greift mit dem österreichischen Sprachkritiker und Satiriker Karl Kraus ins höhere Fach. Die deutsche Sprache, so hat dieser befunden, sei zwar die tiefste, die deutsche Rede aber die seichteste. Und gegen Seichtigkeit hilft nur eines: trotziges Herumreiten auf banalen Phrasen, schiefen Formulierungen, falschen Bildern. Weil in Sprache sich Gesinnung spiegelt, ist das Einschreiten gegen sprachliche Vergehen – so sieht es Daniela Strigl – ein „politisches, ja sogar ethisches Engagement im Sinne von Kraus“.
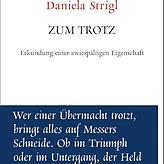
So viele verschiedene Arten von Trotz! Worin also liegt nun der gemeinsame Bezugspunkt, was lässt sich ableiten aus den Geschichten von Desperados und Dissidenten, von Querulanten und Terroristen?
Als man die Hoffnung auf eine befriedigende Antwort schon verloren glaubt, biegt das vorliegende Essay doch noch zumindest auf eine reizvolle These ein. Gerade diese Vielfalt nämlich zeichnet nicht nur den Menschen aus, sondern insbesondere sein Auftreten in der Literatur. Ja, man könnte glatt behaupten, die Kunst, die Literatur selbst sei nichts anderes als eine Form von Trotz: „gegen den Alltag, gegen die wirtschaftliche Nutzbarmachung von allem und jedem, gegen die Überbewertung von Anliegen und Agenda.“
Eine Gesellschaft, die Literatur aus ihrer Mitte verbannt – etwa mittels Lehrplänen, die statt der Klassikerlektüre bloß noch das Schreiben von Lebensläufen und Bedienungsanleitungen vermitteln –, sagt diesem Trotz den Kampf an. Das Ziel ist der rein auf Funktionalität trainierte, um seine Widerständigkeit bereinigte Mensch im Dienst der Gewinnmaximierung. Kann es da noch verwundern, wenn in einer solcherart glattpolierten Wirklichkeit der Trotz sich anderweitig Bahn bricht? Auf Straßen, Wahlzetteln, Kommentarspalten?
Der Trotz gehört wohl zum Menschsein wie Liebe, Angst oder Hoffnung. Man kann ihn beschimpfen, verbieten, tabuisieren. Am Ende kommt er doch immer wieder irgendwo zum Vorschein – trotzdem.








