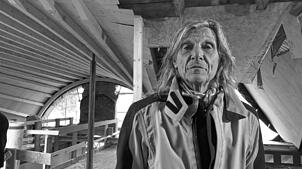Lukas Bosch und Juliane Bublitz sind jetzt nach Rügen gezogen. Keine Lust mehr auf Großstadt. Und die Probleme, denen sie zuletzt in Berlin mit Messer und Gabel zu Leibe gerückt sind, die gedeihen ja auch auf der einsamen Ostseeinsel prächtig. Die Wollhandkrabbe.
Oder die Schwarzmundgrundel, ein kleiner Fisch, der ursprünglich aus dem Schwarzmeerraum kommt und sich auch am Oberrhein explosionsartig vermehrt. Um invasiven Arten Herr zu werden, entwerfen die beiden gerade ein Biermischgetränk aus Sylter Austern, die eigentlich eingeschleppte pazifische sind.
„Dann iss sie“
Und auch die Grundel muss dran glauben: „Räuchern, einlegen, einkochen – wir experimentieren in alle Richtungen“, berichtet Bosch, der seinem zu Berliner Zeiten entwickelten Motto treu geblieben ist: „If you can‘t beat them, eat them“. „Wenn du sie nicht besiegen kannst, iss sie.“
Dass man die invasiven Arten wieder loswird, hält die Wissenschaft für utopisch. Aber so hart es klingt: Jedes invasive Exemplar ist eines zu viel. Signalkrebs, Nutria oder Waschbär haben sich so stark vermehrt, dass sie manche einheimische Spezies an den Rand der Ausrottung bringen: Wo sich, wie in Nordbaden, der Ochsenfrosch breitmacht, haben Grasfrosch und Erdkröte kaum noch eine Chance, ihr Laich schon gar nicht.
Invasive Sandwiches
Die bestechende Idee, dass man eine eingewanderte Art auch dezimieren kann, indem man sie aufisst, kam Bosch und seiner Lebensgefährtin, nachdem sie einen Zeitungstext gelesen hatten. Also gründeten sie mit dem Koch Andreas Michelus „Holy Crab“ und stellten kurz darauf Saucenfonds aus Sumpfkrebsen her. In Foodtrucks verkauften sie invasive Seafood-Sandwiches. Und sie konzipierten ein komplettes Menü.
Unter dem Motto „Jeder Gang eine Plage“ gab es Nutria-Tacos mit Kürbis und Quitte, Bouillabaisse aus Wollhandkrabbe mit Wels und Brunnenkresse, Waschbär-Gulasch auf Gerste und Kräutercreme und Nilgans mit Eigelb-Crumble.
„Krebse und Nutrias aus dem Park sind sowohl exotisch als auch lokal“, sagt Bosch. „Sie leben in freier Wildbahn, müssen also nicht gemästet werden. Sie zu essen ist also radikal nachhaltig.“
Mark Twain aß gerne Waschbären
Allerdings leben wir in Zeiten, in denen viele Menschen schon Innereien, oder gereiften (also nicht geschmacksneutralen) Käse „igitt“ finden. Doch wer Meeresfrüchte und Wild mag, müsse sich eigentlich überzeugen lassen, meint Bosch. Denn ein mit Signalkrebs-Schwänzen belegtes Canapé sieht nicht nur aus wie eines mit einheimischem Krebsfleisch – es schmeckt auch so.
Dass man auch einen Waschbären, der hierzulande Amphibien, Enten und jeder Art von Vogelbrut nachstellt, essen sollte, sei schwerer zu vermitteln: „Die einen wollen das nicht, weil er so niedlich aussieht, und die anderen nicht, weil er im Müll nach Nahrung sucht.“
Dabei wühlen auch Schweine im Dreck. Und auch Ferkel, Kälber oder Rehkitze sind nach allgemeinem Dafürhalten niedliche Tiere – millionenfach gegessen werden sie trotzdem.
Früher war Waschbär in den USA ein Festtagsessen
Wenn es darum geht, ob ein Tier „eklig“ oder essbar ist, ändert sich die Wahrnehmung sowieso innerhalb weniger Jahre. So galt der Waschbär bis vor hundert Jahren vielerorts in den USA als klassischer Hauptgang beim Erntedankfest. Mark Twain führte ihn auf einer Liste heimischer Lebensmittel, die er während seiner Europareise in den 1870er-Jahren vermisste.
Um im 21. Jahrhundert auf möglichst gute Rezepte zu kommen, haben Bosch und sein Team erst mal in den Ursprungsländern der invasiven Tierarten recherchiert. „So etwas wie Beifang gab es vor 100, 150 Jahren nicht – für die meisten Tiere gibt es deshalb Zubereitungsarten.“
Bei der Nutria muss man hingegen nicht experimentieren. Viele Online-Portale für Kulinarik listen Rezepte für gegrillte oder geschmorte Nutria. Zu DDR-Zeiten konnte man das Fleisch beim Fleischer oder im Supermarkt erhalten, viele Bürger hielten ihn im Garten, um mit dem Verkauf des Pelzes ein paar Mark dazuzuverdienen.
Das Fleisch schmeckt wie eine Kreuzung aus Spanferkel und Kaninchen. In Sachsen und am Niederrhein gibt es auch Restaurants, die das Tier auf der Karte haben.
Das Tier, ein enger Verwandter des Bibers, stammt ursprünglich aus Südamerika, erste Pelzfarmen entstanden in Deutschland vor 100 Jahren. Erst als der Pelz-Markt vor einigen Jahrzehnten einbrach, wurden auch wilde Nutrias praktisch nicht mehr gejagt und konnten sich ungehindert vermehren. Heute geben die Landesjagdverbände Quoten vor, wie viele Biber oder Waschbären mit Fallen oder Schusswaffen erlegt werden sollen.
Über 100.000 Nutrias werden zeitweilig pro Jahr geschossen. Das dürfte viele überraschen. Doch wer weiß, dass invasive Arten die Artenvielfalt gefährden und dass sie deswegen „entnommen“ werden müssen, dürfte auch Gerichte aus invasiven Arten mit anderen Augen sehen.
Eine Nutria, die nicht verspeist wird, landet bestenfalls in der Biogasanlage, meist jedoch im Müll. Oder sie kommt auf den „Luderplatz“. Das ist Jägerlatein und bezeichnet den Ort, an dem ein totes Tier abgelegt wird, um ein anderes anzulocken, das geschossen wird.
Die Nilgans ist gerne mal zäh
Allerdings sind nicht alle invasiven Tiere so problemlos zuzubereiten wie die Nutria. Um zu verhindern, dass sie zäh auf den Teller kommt, haben sie störrische Arten wie die Nilgans bei „Holy Crab“ im Vakuumierer („sous vide“) stundenlang vorgegart.
Auch die Wollhandkrabbe macht es europäischen Gaumen nicht leicht. In China ist sie eine Delikatesse. Viele deutsche Binnenfischer, deren Netze von den Plagegeistern zerstört werden, exportieren die Tiere nach China. Dort wird das Tier, das im Gegensatz zu Hummer und Garnele kein Muskelfleisch hat, gedünstet, woraufhin sie der Gast am Tisch aufknackt und sie mit einer Art Brotscheibe austupft.
Hierzulande wäre das kaum zu vermitteln, meint Bosch: „Das Innere sieht wirklich aus wie Alienhirn.“ Bei „Holy Crab“ machen sie deshalb Fonds aus dem Panzer, den „Karkassen“.
Auch dem Vorsitzenden der „Isarfischer“, Klaus Betlejewski machen invasive Arten zu schaffen. „Wir haben aber das Glück, dass wir in München weit weniger davon haben als im Südwesten, wo die Wassertemperaturen höher sind.“ Die Isar ist am Oberlauf schlicht zu kalt für die Schwarzmundgrundel.
Signalkrebse haben sie dafür auch in Oberbayern in rauen Mengen. Die, das hat Betlejewski gerade in einem Vortrag erfahren, sind in den Fünfzigern aus Kanada nach Schweden eingeführt worden, um die durch die Krebspest dezimierten heimischen Edelkrebsbestände aufzufüllen.
Man wusste damals nicht, dass Signalkrebse genau diese Krankheit übertragen. „Die Tiere selbst sind immun. Im Gegensatz zu den heimischen Flusskrebsen, die sie dadurch dezimieren.“ Und das auch vor der eigenen Haustür.
Signalkrebse in der Isar
Vor allem in den Isarkanälen mit ihrer geringen Fließgeschwindigkeit fühlten sie sich wohl. „Man kann an einem Abend schon mal 50 Stück fangen.“ Genau das haben er und seine Kollegen kürzlich auch getan. Und um die Motivation zu erhöhen, hat Betlejewski vorher ein paar Signalkrebs-Rezepte in Umlauf gebracht.
„Ob in Weißwein oder als Risotto – jedes Flusskrebsrezept passt auch für den Signalkrebs.“ Essbar sind allerdings nur die ausgelösten Schwänze der Tiere, und die wiegen nur ein paar Gramm. Betlejewski selbst hat ein paar Dutzend Krebse von Hand gepult und sich daraus ein Pastagericht gekocht. „Eine Heidenarbeit, aber geschmeckt hat‘s prima.“