Frau Hoyer, Politiker im Westen schauen angesichts immer neuer Umfragerekorde der AfD mit Sorge nach Ostdeutschland, wo Unzufriedenheit gärt, obwohl unter dem Dach der deutschen Einheit viel erreicht worden ist. Wo sehen Sie die Probleme im aktuellen deutsch-deutschen Verhältnis?
In den neuen Ländern beschäftigen sich die Menschen sicher nicht täglich aufs Eindringlichste mit den Folgen der Wende. Aber es gibt bei einigen eine Grund-Unzufriedenheit, verbunden mit dem Gefühl, nicht richtig dazuzugehören. Man fühlt sich in einer gesamtdeutschen Gesellschaft nicht adäquat repräsentiert und ernst genommen, vor allem nicht in der Politik.
Im Osten ist die Auseinandersetzung mit den Folgen der Wende – Einheit sagt man dort selten – präsent. Im Westen spielen sie kaum eine Rolle. Ist man hier zu wenig an den Menschen in den neuen Ländern interessiert?
Im Westen hat man die Jahre 1989/90 viel weniger als im Osten als Umbruch empfunden, und deshalb ist es schwer, sich in die Befindlichkeiten der früheren DDR-Bürger hineinzuversetzen. Die sprechen von der Wende, gerade weil sie ihr Leben grundlegend verändert hat. Wenn man, wie im Westen, so weitergelebt hat wie vorher, ist das schwer nachzuvollziehen. Das Meckern über den Soli war ja nicht Teil einer radikalen Änderung in der eigenen Biografie.
Man sieht es im Westen so: Der Osten hat sich erst durch die friedliche Revolution, dann durch Wahlen entschieden, dem Westen beizutreten, auch dessen Mentalität zu übernehmen und dadurch quasi westdeutsch zu werden. Dabei hat man vergessen, dass man im Osten vier Jahrzehnte lang in einem anderen Staat gelebt hat.

Inzwischen gibt es eine junge Generation, die die DDR nie erlebt hat. Schleifen sich die Wendezeit-Brüche mit der Zeit ab?
Ja, das ist so. Ich selbst habe als 1985 Geborene auch nicht mehr den emotionalen Bezug zur DDR, weder positiv noch negativ. Aber man sieht auch unter einigen Jüngeren im Osten Unzufriedenheit und ein seltsames Wir-Gefühl, dass sich neu aufgebaut hat. Es ist aber sozial wie auch regional unterschiedlich, und es kommt darauf an, in welchen Kreisen man sich aufhält. Es ist zwar klar, dass die DDR nicht mehr zum eigenen Geschichte gehört, aber mit anderen historischen Ereignissen ist es ja dasselbe.
Wenn wir etwa im kommenden Jahr den 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes feiern, ist das Ereignis von 1949 bei vielen auch nicht mehr Teil der eigenen Biografie. Es ist auch für Jüngere schwer, sich das als Bestandteil der eigenen Geschichte vorzustellen, denn die Familie lebte ja nicht in der Bundesrepublik.
Leidet der Osten daran, dass seit der Wende viele junge Leute in den Westen gezogen sind?
Ja. Man spricht – auch wie hier in England oder in den USA – von den Left-behind-Gruppen, den Zurückgelassenen. Ganze Landstriche verloren tausende Einwohner, und die Menschen, die da noch leben, reden untereinander über Politik und Gesellschaft. Frust und Ärger werden durch mangelnden Austausch, das Fehlen von Kommen und Gehen, verstärkt.
Für Städte wie Leipzig oder Jena gilt das natürlich nicht. Aber in Gegenden wie dem Thüringer Wald, wo ich Familie habe, nehmen Menschen sehr lange Pendlerfahrten zur Arbeit in Kauf, weil sie ihre Heimat nicht verlassen wollen. Andererseits ziehen dort viele weg. Das verstärkt das Gefühl, alleine und quasi vergessen in immer kleineren Kreisen zu leben.
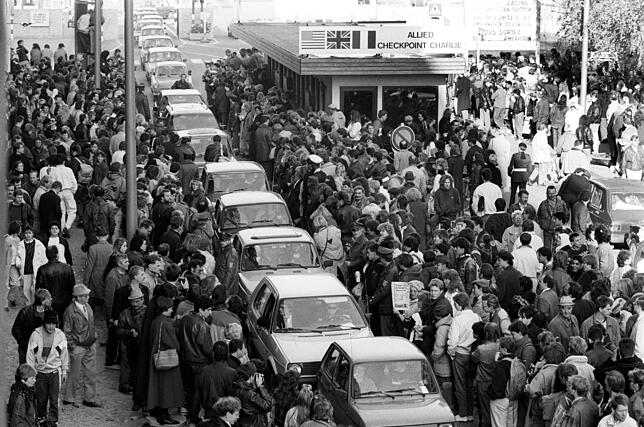
Wie kommt es, dass viele dieser Menschen offen sind für die nationalpopulistischen Aussagen der AfD?
Das große Problem ist: Die Menschen haben das Gefühl, dass sie mit ihren Positionen – weil sie nicht zum politischen Mainstream zählen – nicht gehört werden. Das ist bei Corona sehr deutlich geworden, und es geht weiter. Jedes Mal, wenn ich in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg mit Menschen spreche, habe ich das Gefühl, dass sich das noch mehr radikalisiert und noch wütender wird.
Sind diese Menschen nur in ihrer Blase?
Sie fühlen sich sehr weit entfernt vom politischen Berlin und den Debatten, die man dort führt. Es geht nicht um Gendern oder Nicht-Gendern, sondern darum, dass die AfD in jedem Städtchen vor Ort ist und mit den Menschen redet. Die Parolen stoßen auf Zustimmung, und das wird von den etablierten Parteien in die Neonazi-Ecke gerückt. Sie wollen Brandmauern errichten, aber keinen echten Dialog führen.
Das hat mit Jobs und Geld wenig zu tun?
Kaum. Meistens geht es den Menschen gar nicht so schlecht. Es sind in der Masse die typischen kleinen Leute, Handwerker und Angestellte des unteren Mittelstands, die in den ländlichen Regionen wohnen. Sie kommen mit ihrem Geld gerade so hin und sagen dann: Olaf Scholz kennt nicht mal die Benzinpreise. Oder: Wie wollen uns die da oben in Berlin sagen, wie wir unser Haus heizen sollen! Das ist eine Grund-Frustration. Die anderen Parteien sind kaum greifbar, und die AfD springt in die Lücke und schürt ein neues Wir-gegen-die-Gefühl.
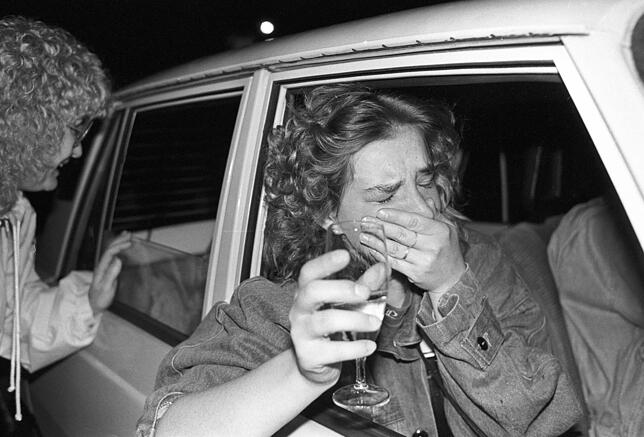
Das hat mir einer Ostalgie-Haltung gar nichts zu tun?
Nein. Es gibt aber ein Narrativ, dass man schon 1989 auf der Straße war, um sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen. Das wird heute wieder verwendet. Daher haben die Populisten an die Leipziger Montagsdemos angeknüpft. Jetzt heißt es: Wir wissen, wie Diktatur funktioniert und lassen uns nicht sagen, wie wir zu leben haben. Die Ostalgiker, wenn es sie denn noch gibt, wenden sich eher der Linkspartei zu, vorwiegend in Thüringen, wo die Linke stark ist.
Wissen die Anhänger der Rechtspopulisten, dass die Demokratie das Beste ist, was wir haben?
Viele AfD-Wähler sehen die aktuelle Parteienlandschaft als ewiges Weiter-so. Alle anderen Parteien erscheinen dabei als links oder in der Mitte angesiedelt. Bestätigt sehen sie sich auch im Kurs von Angela Merkel, die die CDU sozialdemokratisiert hat. Die erste große Enttäuschung war dann ihre Flüchtlingspolitik, die sie als alternativlos dargestellt hat. Die Menschen sahen zwischen der Mitte und ganz Rechtsaußen eine große Lücke, und die AfD füllt die nun und nutzt das Ohnmachtsgefühl aus. Das darf man nicht als undemokratisch abschreiben. Die Leute sehen die Wahl der AfD als demokratischen Ausdruck ihres Unmuts. Da hilft nur Dialog.
Ist das eine Art Montagsdemo – nur AfD-blau eingefärbt?
Nicht ganz. Die meisten AfD-Wähler gehen nicht auf die Straße, sie machen einfach still ihr Kreuzchen. Politik ist nicht unbedingt ihr Lebensmittelpunkt, sondern etwas, was die Menschen ärgert, wenn sie zu Hause darüber reden oder Nachrichten schauen. Daher sind sie für die Politik nicht sichtbar, und man kommt schwer an sie ran. Die Debatte etwa um das Heizungsgesetz hat bei ihnen ein Fass zum Überlaufen gebracht, und sie votieren in Umfragen für die AfD. Ob sie die dann tatsächliche wählen, ist eine andere Frage.
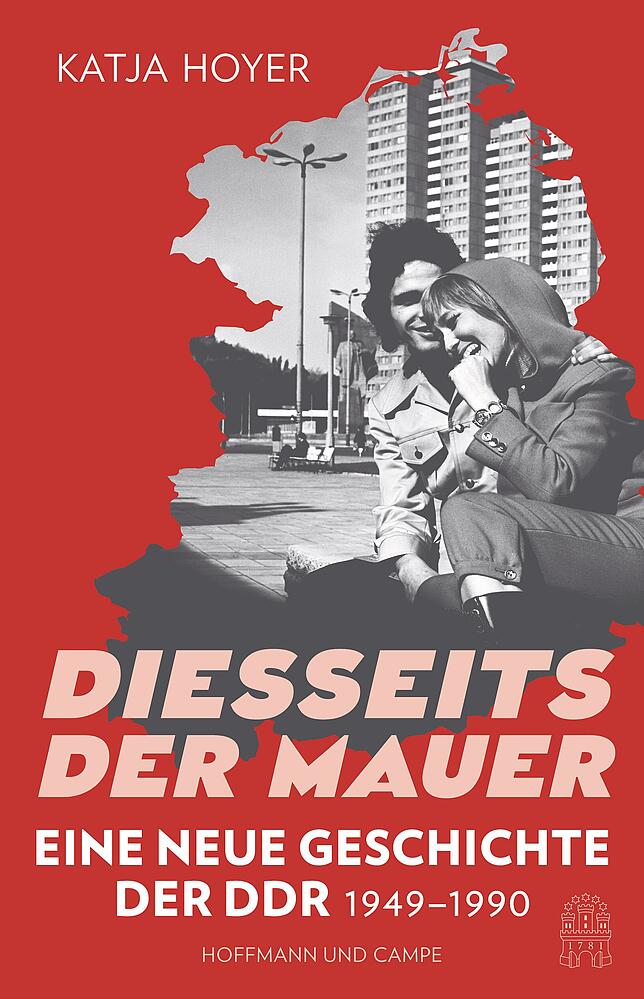
Der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann aus Gotha wirft dem Westen Arroganz vor. Er sagt, der Westen setze die Normen dafür, was auch im Osten als normal zu gelten habe. Übertreibt er da?
Man muss unterscheiden. Oschmann meint vor allem die West-Eliten, die Leute aus der Politik und den Medien, die den Ton angeben. Das habe ich selbst auch so erlebt. Ich habe mich so lange nicht ostdeutsch gefühlt, bis ich regelmäßig mit Westdeutschen zu tun hatte. Hier in England ist das vorbei, hier bin ich nur German.
Bekommen Sie auf Ihr Buch, in dem Sie sich dagegen wehren, dass man die DDR zu einer Fußnote der deutschen Geschichte herabstuft, auch Reaktionen aus dem Westen?
Ja. Es gibt Leser, die mir schreiben und sagen: Ich habe mich vorher nie mit der DDR beschäftigt. Sie finden es gut, etwas zu lesen, was nicht allein durch die politisierte Optik geprägt ist und die DDR nicht nur als die zweite Diktatur und als Gegenmodell zur Bundesrepublik schildert, sondern auch als Lebenswelt normaler Bürger, die am Staat vorbei oder auch mit dem Staat konform gelebt haben.
Der Kontrast zu der hitzigen Reaktion auf das Buch in einigen Zeitungen hat gezeigt, dass es Neugier am Osten gibt, aber auch, dass es einigen noch immer schwerfällt, die DDR als Teil der deutschen Geschichte zu sehen. Es wäre wünschenswert, im Westen nicht nur auf den eigenen Teil der Geschichte zu blicken, sondern auch auf den Staat, der einmal jenseits der Mauer lag. Denn im Osten versucht man ja auch, beide deutsche Staaten zu sehen, vor allem ihre Buch-, Film- und Musikkultur. Das wäre mein Appell.
Dann wollen wir mal versuchen, eine zu Brücke bauen. Welchen Ost-Autor empfehlen Sie Wessis, wenn Sie über die DDR jenseits von Mauer und Stasi etwas erfahren wollen?
Vielleicht einen Roman der im Westen weniger bekannten Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973, Anmerkung der Redaktion), etwa „Die Geschwister“. Sie hat kritische Ost-West-Erfahrungen gemacht, die sie dann in ihren Büchern verarbeitet hat. Reimann wurde von vielen DDR-Jugendlichen gern gelesen, weil ihre Texte weniger glattgebügelt und durchaus kritisch formuliert waren. Auch den Kinderfilm „Alfons Zitterbacke“, in dem der Held Kosmonaut werden will, kann man sich durchaus noch heute anschauen. (lacht)






