Tausende Besitzer von Äckern, Streuobstwiesen oder Waldstückchen haben in letzter Zeit Post vom Finanzamt bekommen. Es geht – wie könnte es anders sein – um die Grundsteuer.
Denn nicht nur Häuslebauer und Wohnungsbesitzer müssen ihre Grundsteuerdaten dem Amt melden, sondern auch alle, die über landwirtschaftliche Flächen verfügen. Egal, ob sie Bauer sind, oder nicht. „Viele Landbesitzer sind total verzweifelt, weil sie mit den Formularen nicht zurecht kommen“, sagt ein Experte. Ein Überblick, was jetzt zu tun ist:
Ich habe eine Wiese, einen Wald oder einen Acker. Was muss ich jetzt tun?
Wer ein land- oder forstwirtschaftliches Grundstück besitzt, muss dafür genau wie Immobilienbesitzer auch, seine Grundsteuerdaten neu erfassen. Dafür ist es unerheblich, ob er dort aktiv eine Landwirtschaft betreibt, sogar Vollerwerbsbauer ist oder die Wiese nur als Freizeitfläche nutzt und hin und wieder ein paar Äpfel aufliest. „Auch wer kein aktiver Landwirt ist, muss dem Amt die Daten liefern“, sagt Alexis von der Horst, Steuerberater bei Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (BLHV) in Freiburg.
Bis 31. März muss das entsprechende Online-Formular im Steuerprogramm Elster ausgefüllt und abgeschickt sein. In Ausnahmefälle ist es auch möglich, Papierformulare zu nutzen, die vom Finanzamt bereitgestellt werden.
Wird die Frist gerissen, wird die Säumnis angemahnt. In letzter Konsequenz drohen auch Bußgelder. Die Finanzämter hätten aber signalisiert, dass eine nur leicht verspätete Abgabe zunächst nicht sanktioniert werde, sagt von der Horst. „Auch wir sind mit den Anträgen bis zum 31. März mit Sicherheit nicht durch“, sagt er. Dafür seien es einfach „viel zu viele“.
Wie gehe ich jetzt vor?
Wer bereits die Grundsteuer B für Wohnimmobilien ausgefüllt hat – was für die allermeisten mittlerweile zutreffen sollte – nutzt für die Grundsteuer-A-Erklärung für landwirtschaftliche Grundstücke ebenfalls das Programm Elster. Dort sind im Normalfall die Vordrucke GW 1, also der Hauptvordruck, sowie GW 3 – also die Anlage Land- und Forstwirtschaft – relevant. Wer eine Wiese oder einen Acker besitzt, kann in diesen beiden Dokumenten alle relevanten Daten hinterlegen.
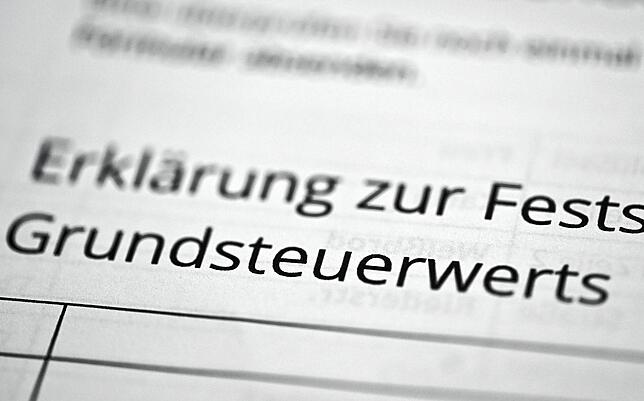
Welche Daten brauche ich und wo bekomme ich sie her?
Nötig zum Ausfüllen sind die Steueridentifikationsnummer, das Steuer-Aktenzeichen, die Lagebezeichnung, der Name der Gemarkung, die Gemarkungsnummer, die Fläche sowie deren Nutzungsart und die Ertragsmesszahl der Parzelle. Was sich viel anhört, ist es eigentlich nicht.
Die meisten Daten befinden sich bereits auf dem Anschreiben des Finanzamts. Ergänzend muss allerdings das Geoportal Baden-Württemberg herangezogen werden. Auf der Webseite https://grundsteuer-a.landbw.de muss unter der Such-Funktion die Gemarkung des Grundstücks und die Flurstücknummer eingegeben werden.
Welche Daten erhalte ich dort?
Alles, was die Lage des Grundstücks und dessen landwirtschaftliche Qualität beschreibt, wird hier aufgelistet. Dazu gehört beispielsweise die Ertragsmesszahl – eine Wert für die Bodenqualität – oder die Fläche der Parzelle. Auch etwa Flurstück-Zähler und -Nenner sind dort hinterlegt.

Hauptfeststellung, Ertragsmesszahl und Flurstück – wer erklärt mir all die Fachbegriffe?
Juristendeutsch ist manchmal schwer verständlich. Die Steuerverwaltung hat aus früheren Pannen gelernt und den Schreiben für die Grundsteuerreform (Grundsteuer A) eine Ausfüllhilfe beigelegt. Diese bietet – Zeile für Zeile – Erläuterungen, wie es denn wirklich gemeint ist und wie man die Punkte konkret abarbeitet. Auch wenn manche Zeilen freigelassen werden können, ist das vermerkt.
Die Hilfestellungen zu beachten, lohnt sich also auch zeitlich. „Alle Hürden lassen sich so aber in den seltensten Fällen umschiffen“, warnt Steuerexperte von der Horst. Manches müsse man einfach wissen oder erraten, etwa dass eine Steuobstwiese unter die Kategorie „Landwirtschaftliche Nutzung“ falle und nicht unter „Obstbau“. Das gilt nur für Plantagen.
Muss ich die Grundsteuererklärung selbst ausfüllen?
Nein, das kann auch ein Vertreter, etwa ein Steuerberater, übernehmen. Auch die nächsten Verwandten, etwa die Kinder, können das tun. In jedem Fall muss deren Mithilfe aber auf der Erklärung vermerkt werden.
Was passiert, wenn es mehrere Eigner der Fläche gibt?
Dem Finanzamt reicht es in diesem Fall, wenn eine der Personen – etwa innerhalb einer Erbengemeinschaft – die Grundsteuererklärung verfasst. Es müssen also nicht alle aktiv werden.
Was ist, wenn auf Teilen der Wiesen oder Äcker Wohngebäude stehen?
„Dann wird es sehr kompliziert“, sagt von der Horst vom BLHV. Grundsätzlich gelte nämlich, dass alle bewohnten Gebäude auf solchen Flächen formal nicht mehr dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet werden, sondern der Grundsteuer B für Wohngebäude unterliegen. Und dafür müsse dann ein separater Vordruck, eben für die Grundsteuer B, ausgefüllt werden.
„Das geht dann fast nur mit Steuerberater“, sagt von der Horst. Für BLHV-Mitglieder, was aber meist nur Landwirte sind, bietet der Verband über seine hauseigene Steuerkanzlei – die Buchstelle – kostenpflichtige Beratungsdienstleistungsleistungen. „Allein das bringt uns hier schon ans Limit“, sagt er.
Wird es jetzt teurer?
Das ist im Moment noch nicht zu sagen. „Die Hebesätze der Gemeinden sind noch nicht festgelegt“, sagt Fachmann von der Horst vom BLHV. Die Kommunen, auf denen sich die Grundstücke befinden, sind aber angehalten, das Grundsteueraufkommen insgesamt gleich zu halten. Das heißt aber nicht, dass es nicht innerhalb einer Ortschaft zu steuerlichen Verschiebungen kommen kann.
Von der Horst kann zum jetzigen Zeitpunkt daher nur sagen, dass die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen generell viel günstiger ist als die für Wohngebäude gültige Grundsteuer B. Ausschlaggebend für die Höhe der Steuer ist bei landwirtschaftlichen Flächen die Ertragsmesszahl, also die Güte des Bodens. Ist sie hoch, fällt auch die Steuer höher aus als auf mageren Äckern.






