Rund eine Viertel Million Mini-Photovoltaikanlagen, auch Balkonkraftwerke oder Stecker-Solar-Geräte genannt, gibt es Schätzungen zufolge inzwischen in Deutschland. Man kann sie für ein paar hundert Euro sogar bei Supermarktketten kaufen und einfach selbst installieren – theoretisch zumindest. Rechtlich stehen dem derzeit noch ein paar Hürden im Weg, doch diese sollen bald fallen. Darum geht es im Einzelnen.
Darf man ein Balkonkraftwerk selbst installieren?
Bislang sieht die Norm für Balkonkraftwerke in Deutschland vor, dass diese nur mit einem so genannten Wielandstecker betrieben werden dürfen – und eben nicht über eine haushaltsübliche Schuko-Steckdose. „Das ist nochmals eine extra Schutz, wenn beispielsweise Kinder den Stecker ziehen und die PV-Anlage vom Netz trennen würden“, sagt Marianne Crevon, Expertin für Photovoltaikanlagen bei der Klimaschutzagentur Mannheim.
Allerdings gibt es diese Extra-Vorschrift für den Stecker EU-weit nur in Deutschland – und es ist geplant, die Norm hierzulande auch so anzupassen, dass eine normale Schuko-Steckdose reicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, engagiert einen Handwerksbetrieb oder einen spezialisierten Anbieter, von denen es in der Region einige gibt. So bietet beispielsweise auch die SÜDKURIER-Tochter Eliotec seit einiger Zeit die Installation schlüsselfertiger Balkonkraftwerke an.

Muss man das Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber anmelden?
Eigentlich schon, auch das sieht die Norm vor. „Wir gehen aber davon aus, dass es in Deutschland inzwischen rund eine Viertel Million Balkonkraftwerke gibt, offiziell angemeldet sind aber nur 120.000“, sagt Marianne Crevon. Das hänge mit den Steckdosen zusammen, denn auf dem Anmeldeformular beim Netzbetreiber muss bestätigt werden, dass eine normgerechte Einspeisesteckdose eingebaut ist, so Crevon.
Hinzu kommt, dass das Anmelden zwar nichts kostet – für den Verbraucher aber schlicht Papierkram bedeutet, vom der nicht direkt etwas hat. Marianne Crevon empfiehlt es dennoch. „Nur so haben die Netzbetreiber einen Überblick darüber, wie viel Strom die Haushalte selbst erzeugen. Für die Stabilität der Stromnetze ist das wichtig zu wissen.“
Braucht man für das Balkonkraftwerk einen neuen Stromzähler?
Wer einen älteren Stromzähler ohne Rücklaufsperre hat, muss diesen vom Netzbetreiber tauschen lassen, bevor er eine Mini-PV-Anlage anschließt. Andernfalls läuft der Zähler nämlich rückwärts, sobald überschüssiger Sonnenstrom ins Netz eingespeist wird. Und das Zurückdrehen von Stromzählern gilt in Deutschland als Manipulation, die unter Strafe steht: zwei bis fünf Jahre Freiheitsstrafe oder mit eine Geldstrafe. Allerdings wird auch hier derzeit über eine gesetzlich Änderung diskutiert, die entweder das Rückwärtslaufen erlauben soll, was für die Verbraucher eine zusätzliche finanzielle Motivation für ein Balkonkraftwerk wäre. Zumindest aber sollen die alten Zähler künftig so lange geduldet werden, bis der Netzbetreiber einen neuen Zähler eingebaut hat.
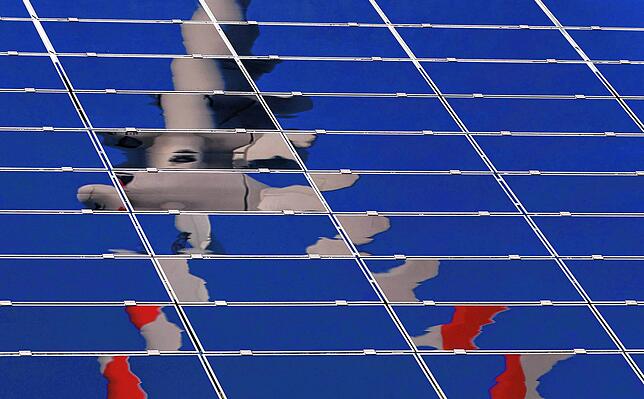
Lohnt es sich, eine Einspeisevergütung zu beantragen?
Wenn der Stromzähler nicht rückwärts läuft, schenken die Haushalte dem Netzbetreiber überschüssig produzierten Strom aus den Balkonkraftwerken. Es sei denn, sie geben bei der Anmeldung der Anlage an, dass sie eine Einspeisevergütung beantragen. „Dieser Papierkram lohnt sich aber meist nicht dafür, dass man am Ende des Jahres vielleicht zehn Euro bekommt“, sagt Marianne Crevon.
Denn Balkonkraftwerke sind vor allem dazu gedacht, den gerade im Haushalt verbrauchten Strom zu erzeugen. In der Regel geht es dabei lediglich um die so genannte Grundlast. Das ist der Strom, der rund um die Uhr und unabhängig von den Bewohnern anfällt – also beispielsweise für den Kühlschrank oder den Wlan-Router.
Nach wie vielen Jahren amortisiert sich ein Balkonkraftwerk?
Das hängt stark davon ab, wie hoch die Grundlast an Strom im Haushalt ist, wie stark man den Stromverbrauch an die Sonne anpassen kann – indem man beispielweise dann wäscht oder die Spülmaschine einschaltet, wenn die Sonne gerade optimal auf die am Gebäude angebrachte PV-Anlage scheint – und ob die Kommune Fördergelder dafür bereit stellt.
In Friedrichshafen beispielsweise gibt es pauschal 300 Euro pro Anlage und Wohneinheit, beziehungsweise Stromzähler. Da amortisiert sich eine Anlage, die zwischen etwa 500 und 800 Euro kostet (ein oder zwei Module) schnell.
Außerdem ist geplant, die Leistungsmenge, die man mit einer PV-Anlage erzeugen darf, ohne dass ein Fachmann sie anbringen muss, von 600 auf 800 Watt anzuheben – wodurch die Balkonkraftwerke künftig noch mehr zum täglichen Stromverbrauch beitragen können. Bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin gibt es einen Stecker-Solar-Simulator. Damit kann man ausrechnen, wie viel Strom und Geld sich mit einem Balkonkraftwerk etwa einsparen lassen.

Braucht man die Zustimmung des Vermieters, um ein Balkonkraftwerk anzubringen?
Sobald man in die Bausubstanz eines Gebäudes eingreift, ja. „Und eine PV-Anlage anzubringen, ohne zu Bohren ist praktisch nicht möglich“, sagt Marianne Crevon. Auch bei Wohneigentümergemeinschaften (WEG) muss die Mehrheit zustimmen. Das hat schon zu Auseinandersetzungen vor Gericht geführt, unter anderem in Konstanz.
Allerdings hat die Justizministerkonferenz bereits beschlossen, dass das Anbringen eines Balkonkraftwerks zur so genannten privilegierten baulichen Veränderung erklärt wird. Das muss jetzt noch vom Bundesjustizministerium umgesetzt werden. „Dann brauchen Vermieter oder WEGs sehr gute Gründe, wenn sie das noch ablehnen wollen“, sagt Marianne Crevon.





