„Großartig, der Truck. Einfach nur großartig.“ Thomas Patzer, dunkel getönte Sonnenbrille, weißer Cowboy-Hut, ist mächtig stolz auf die 36 Tonnen geballte Technik, die er unter seinem Trucker-Hintern hat. Gerade hat der Hyundai-Testingenieur seinen leise surrenden Schwerlaster in eine Tankstelleneinfahrt im Schweizerischen St. Gallen hineinmanövriert und vor Dutzenden Journalisten und Industrievertretern zum Stehen gebracht. Glaubt man dem, was an diesem Nachmittag Anfang Juli in dem Schweizer Städtchen gesagt werden wird, hat er damit ein Stück Geschichte geschrieben.
Die Schweiz schaltet um auf Wasserstoff, und die Betankung des ersten Brennstoffzellen-Trucks in St. Gallen soll den Startschuss für den Aufbruch des Landes in eine grüne Mobilitäts-Zukunft markieren. Der Lastwagen ist der erste von insgesamt 1600 emissionsfreien Brennstoffzellen-Fahrzeugen, die 2025 Güter über die Straßen der Eidgenossenschaft transportieren sollen.
Parallel dazu forciert eine Industrieinitiative den Ausbau eines flächendeckenden Tankstellennetzes. „Zwischen Bodensee und Genfer See“ sollen an zunächst sechs Tankstationen Wasserstoff-Zapfsäulen eingerichtet werden. Und ein Wasserkraftwerk in der Zentralschweiz soll ab 2021 mit der Produktion von grünem Wasserstoff beginnen. Gelingt all das, wird die Schweiz das erste Land weltweit sein, das eine große Flotte aus Brennstoffzellen-Fahrzeugen im Dauerbetrieb einsetzen wird.

Damit ginge sie einen großen Schritt in Richtung klimaneutraler Verkehr. Denn mit Hilfe von Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien hergestellt und in Brennstoffzellen in Strom umgewandelt wird, ist Mobilität ohne Ausstoß von Treibhausgasen möglich.
„Was hier in der Schweiz gerade passiert, ist einmalig“, sagt Bertrand Piccard. „Kein anderes Land der Welt macht so etwas gerade.“ Der Förderverein H2 Mobilität Schweiz, der hinter der Wasserstoff-Offensive steht, hat den Entdecker als Galionsfigur für das Projekt verpflichtet. Nachdem er sowohl mit einem Heißluftballon als auch mit einem Solarflugzeug die Erde umrundet hat, traut man ihm auch zu, das Öko-Projekt zum Fliegen zu bringen.
Andere Verkehrspolitik in der Schweiz
Piccard brennt seit Jahren für das Thema. Den Umbau der Wirtschaft von fossilen Energien hin zu Wasserstoff als zentralem Energieträger bezeichnet er als „logisch und ökologisch“. Damit hat er einen Nerv getroffen. Einen Tag nach den Schweizern verkündete die Europäische Union an diesem Mittwoch ihre eigene, 400 Milliarden Euro schwere Wasserstoffstrategie. Bereits im Juni hatte Deutschland angekündigt, in den kommenden Jahren neun Milliarden Euro in die Technologie zu stecken. Der deutsche Maschinenbauverband VDMA rechnet damit, dass durch neue Antriebsformen wie die Brennstoffzelle in Europa bis 2040 fast 70 000 neue Jobs geschaffen werden, etwa bei den kriselnden deutschen Automobilzulieferern.
Die Schweiz indes scheint insbesondere bei der Umstellung des klimaschädlichen Transport- und Verkehrssektors nicht nur deutlich schneller voranzukommen als viele andere Länder, sie setzt auch andere Prioritäten.
VDMA: Fast 70.000 neue Jobs durch Brennstoffzelle
Während Deutschland und die EU die Technologiewende durch zentral gesteuerte Mega-Programme vorantreiben wollen, sei man in der Schweiz rein „unternehmerisch und privatwirtschaftlich“ vorgegangen und habe auf Staatseinflüsse verzichtet, sagt Jörg Ackermann vom Verein H2 Mobilität Schweiz. Ackermann ist einer der geistigen Väter des Schweizer Wasserstoff-Engagements. Den Erfolg des Schweizer Wegs umschreibt er so: „Alle Akteure an einen Tisch, alle diskutieren auf Augenhöhe“. So hat es die Initiative geschafft, ein stabiles Netzwerk aus genossenschaftlichen Tankstellenbetreibern, mittelständischen Maschinenbauern, Einzelhandelsriesen und dem Nutzfahrzeug-Weltkonzern Hyundai zu formen. Staatlicher Förderung trauert er nicht nach. Am Ende müsse sich das Geschäft ja sowieso von alleine tragen, sagt er. Und ohne den Staat sei man deutlich schneller unterwegs.
Allerdings setzt die Schweizer Verkehrspolitik auch den richtigen Rahmen. Während Deutschland den Diesel steuerlich seit Jahrzehnten privilegiert und erst seit Kurzem Kaufanreize für Elektroautos auslobt, machen es die Eidgenossen seit der Jahrtausendwende anders herum.
Lkw mit Verbrennungsmotor bezahlen seit 2001 die sogenannten Schwerverkehrsabgabe. Bei emissionsfreien Antrieben wie der Brennstoffzelle entfällt der sehr teure Staats-Aufschlag. Für Speditionen ist das ein enormer Anreiz zum Umstieg.
Daimler bringt Trucks erst 2025
Im Schweizer Wasserstoff-Projekt kaufen die Speditionen die neuartigen Trucks nicht, sondern leasen sie bei einem Tochterunternehmen des Herstellers Hyundai. Dieses garantiert für die technische Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge und für Preise, die „nicht wesentlich von denen herkömmlicher Diesel-Lkw abweichen“. Das geht, weil die Schwerverkehrsabgabe entfällt.
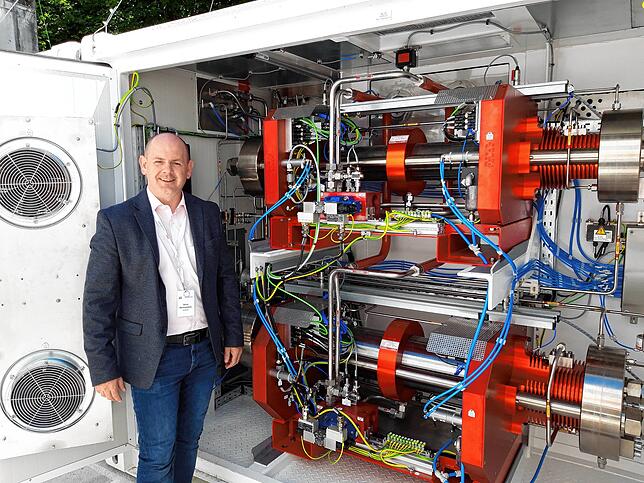
Klar ist aber auch, dass insbesondere Hyundai bei dem Projekt nicht mit spitzer Feder kalkuliert. Für die Koreaner, die als Nutzfahrzeughersteller in Europa noch unbekannt sind, ist die Brennstoffzellentechnologie die Chance auf Prestige und zukünftige Geschäfte. „Wir wollen in Europa neue Märkte erschließen“, sagt Mark Freymüller, Chef der Hyundai-Tochter, die die Trucks verleast. „Ohne die Brennstoffzelle wäre uns der Kontinent sicher verschlossen geblieben“, sagt der Manager, der früher für den weltgrößten Truckbauer Daimler gearbeitet hat.

Die europäischen Platzhirsche wie Daimler, Volvo oder die VW-Tochter MAN haben haben dem Wasserstoff-Vordenker Ackermann und seiner Initiative übrigens einen Korb gegeben. Ob ihnen das Engagement zu teuer war oder ob sie die entsprechenden Fahrzeuge nicht hatten, will er nicht verraten. Wahrscheinlich ist L
letzteres der Fall. Erst 2025 will Daimler erste Schwerlaster mit Brennstoffzelle auf die Straße bringen. Läuft alles nach Plan, fahren dann in der Schweiz schon 1600 Fahrzeuge vom Konkurrenten Hyundai. Ackermann nimmt‘s gelassen: „Wir sind happy über jeden Hersteller, der bei der Brennstoffzelle einsteigt“. Und sei es etwas später.
„Wohlstand und Umweltschutz passen sehr wohl zusammen“
Bertrand Piccard, geboren 1958 in Lausanne, umkreiste mit Ballon und Solarflugzeug die Erde. Heute setzt er sich für Zukunftstechnologien ein.
Herr Piccard, Sie gelten als einer der größten Abenteurer unserer Zeit und sind ein Verfechter von Öko-Energien. Lassen wir uns beim Thema Wasserstoff nicht auf ein Abenteuer ein?
Nein, gar nicht. Warum?
Seit Jahrzehnten wird an der Brennstoffzelle und Wasserstoffantrieben geforscht, aber es gibt noch immer Vorbehalte bei Sicherheit und Kosten…
Das sind vorgeschobene Argumente. Dass es nicht schneller geht, hängt mit unserer Unfähigkeit zusammen, das Neue konsequent zu denken und dann entschlossen zu handeln. Wir sind allzu oft Gefangene von überkommenen Paradigmen. Ein Beispiel: Als ich Ende des vergangenen Jahrzehnts mit meiner Idee, mit unserem Solarflugzeug Solar Impulse ohne Hilfsmittel die Welt zu umrunden, bei Fachleuten vorsprach, dauerte es ungefähr eine Minute, bis sie mir erklärt hatten, dass das ganz und gar unmöglich sei. Unser Team hat aber weitergemacht und 2016 haben wir es tatsächlich geschafft. Wir sind ohne Sprit rund um die Welt geflogen. Es ging also sehr wohl. Beim Thema Wasserstoff ist das ähnlich.
Das heißt, Sie halten es für möglich, dass eine Wirtschaft komplett von fossilen Brennstoffen weggeht und sich in eine Wasserstoffwirtschaft wandelt?
Ja natürlich. Dafür müssen wir aber vom Dogma der Mehr-Produktion wegkommen. Das ist ein ökologisches Desaster. Vielmehr müssen wir Energie effizienter einsetzen. Warum verwenden wir Verbrennungsmotoren, die einen Wirkungsgrad weniger als 30 Prozent aufweisen? Der Elektro-Motor hat gut 80 Prozent. Warum dämmen wir unsere Häuser nicht endlich besser? Warum werden wir in industriellen Prozessen nicht viel effizienter? Alle diese Technologien stehen bereit, wir müssen sie nur einsetzen. Dann ist übrigens auch Wachstum kein Problem mehr. Es ist aber dann vom Ressourcenverbrauch entkoppelt. Wohlstand und Umweltschutz passen sehr wohl zusammen. Gerade jetzt in der Krise brauchen wir mehr Impulse, alte Technologien durch neue, saubere zu ersetzen. Die Zeit ist reif dafür.
Die Widerstände werden enorm sein. Immerhin hängen ganze Branchen an diesen alten Technologien….
Ich bezweifle das. Man muss es nur geschickt anstellen. In der Schweiz sehen wir gerade, dass Mineralöl-Unternehmen die Treiber hinter einem einzigartigen Wasserstoff-Projekt sind. Ihnen ist klar, dass sie in 20 Jahren nicht mehr einfach Benzin und Diesel verkaufen können. Daher investieren sie jetzt in grünen Wasserstoff. Genauso könnte man auch viele Erdölfördernationen, etwa im Nahen Osten, überzeugen, in ihren Wüsten Solarstrom zu produzieren und damit grünen Wasserstoff zu raffinieren. Der käme dann per Tankschiff nach Europa. Erdöl geht ja sowieso irgendwann aus. Das alles ist logisch. Und es ist ökologisch.
Fragen: Walther Rosenberger






