Frau Klodt-Bußmann, zu Ihrem Amtsantritt vor rund einem halben Jahr haben sie der regionalen Wirtschaft in Summe eine „gute Verfassung“ bescheinigt. Sind Sie immer noch positiv gestimmt?
Klodt-Bußmann: Die Auftragslage der Firmen sowie deren Erwartungen für die kommenden Monate hat sich seither eher eingetrübt. Grundsätzlich sind die Unternehmen aber immer noch in einer guten Position. Wir müssen aber alle härter als zuvor daran arbeiten, dass es auch so bleibt. Richtig ist, dass Problemfelder wie der Fachkräftemangel, die nach wie vor hohen Energiepreise oder die überschießende Bürokratie die Firmen auszehren.

Bliestle: Die Substanz der Firmen ist gut und solide. Die aktuellen politischen Rahmenbedingungen machen es uns aber nicht leichter. Im Gegenteil. Wenn die Probleme nicht sehr bald nachhaltig angepackt werden, sehe ich tatsächlich schwarze Wolken auf den Standort zukommen. Wir spüren das jetzt schon an der Grundstimmung in den Betrieben, aber auch an harten Kennzahlen, etwa am regionalen Arbeitsmarkt, der sichtbar schwächelt.

Wo hapert es am meisten?
Bliestle: Die Bürokratie in Deutschland erdrückt uns. Ich kann das Thema zwar selbst schon fast nicht mehr hören, aber es ist einfach so.
Klodt-Bußmann: Wir müssen in Sachen Bürokratie einen harten Schnitt machen, uns von ganz vielem Trennen und uns die Freiheit nehmen, Dinge neu zu denken. Mit dem Ansatz, auf bereits Bestehendes immer wieder neue Regeln draufzusatteln, kommen wir in Deutschland nicht mehr weiter. Im Gegenteil. Wir werden so weiter zurückfallen. Dabei vergessen wir, dass eine starke Wirtschaft die Bedingung für Wohlstand und auch für gesellschaftlichen Frieden im Land ist.
Woran liegt es, dass die Dinge sich nicht bessern?
Bliestle: Das Problem ist vielschichtig. Die Entlastung muss seitens Land, Bund und der EU vorangetrieben werden. Ich nehme jedoch wahr, dass zwar der Wille insbesondere auf Landes- und Bundesebene zur Erleichterung vorhanden ist. Jedoch sind die entlastenden Maßnahmen angesichts vieler neuer Vorschriften, die bürokratischen Aufwand mit sich bringen, leider für die Unternehmer nicht wesentlich wahrzunehmen. Die Belastung nimmt unter Strich noch immer zu. Das frustriert ungemein.
Machen Sie doch ein konkretes Beispiel?
Klodt-Bußmann: Das Verfahren zur Fachkräfteeinwanderung ist leider sehr komplex, inhaltlich und behördenübergreifend –ein negatives Musterbeispiel. In Deutschland sind mehrere Anlaufstellen beteiligt. Die eine unterstützt die Fachkraft beim Sammeln von Unterlagen, darf aber nicht inhaltlich tätig werden. Eine weitere Stelle prüft die Unterlagen nur inhaltlich und eine dritte ist ausschließlich für deren Anerkennung zuständig.
So ein Prozess dauert auch mal ein halbes Jahr. Es endet dann bei den Auslandskonsulaten, wo das Verfahren zur Erteilung des Visums nicht digitalisiert ist, was zu immensen Staus bei der Bearbeitung führt. Welches Unternehmen kann so lange warten? Welche Fachkraft hat so lange Zeit? Zumal andere Staaten diesen Prozess in zehn Tagen schaffen.
Bliestle: Der Konkurrenzkampf um Fachkräfte wird auch innerhalb Europas größer. Wir als Deutsche gehen fälschlicherweise immer noch von der Annahme aus, wir seien das Sehnsuchtsland für Hochqualifizierte. Das ist aber nicht der Fall. Wir müssen uns strecken, die guten Leute zu bekommen. Und bürokratische Hürden erschweren das zusätzlich.

Auch bei dem heimischen Fachkräftenachwuchs hapert es. Wenige Wochen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahrs sind deutschlandweit noch fast die Hälfte der Azubi-Stellen unbesetzt. Warum ist das so?
Klodt-Bußmann: Die Bewerberzahlen sind auch bei uns in der Region rückläufig. Teils ist das demografisch bedingt, aber eigentlich ist das Thema hausgemacht. Deutschland hat zu lange stark das Abitur und Akademiker gesetzt und die Vorzüge der dualen Ausbildung nicht klar genug benannt. Diese sind aber vorhanden und werden auch größer werden, denn um den Umbau Deutschlands zu leisten, brauchen wir Menschen, die in alle erforderlichen Bereiche der Wirtschaft abdecken.
Was raten Sie den Jugendlichen?
Klodt-Bußmann: Wer als Jugendlicher eine Ausbildung anstrebt, hat sehr gute Berufsaussichten, auch mit Blick auf das Gehalt. Wir arbeiten hart daran, den Ausbildungsberuf gesellschaftlich aufzuwerten, aber dieser Prozess braucht Zeit.
Bliestle: Viele Jugendliche wissen gar nicht, dass eine gute Ausbildung eine sehr gute Grundlage sein kann, auch um höhere Bildungsabschlüsse auf Bachelorniveau zu erreichen. Diese Weiterbildungen können berufsbegleitend absolviert werden.
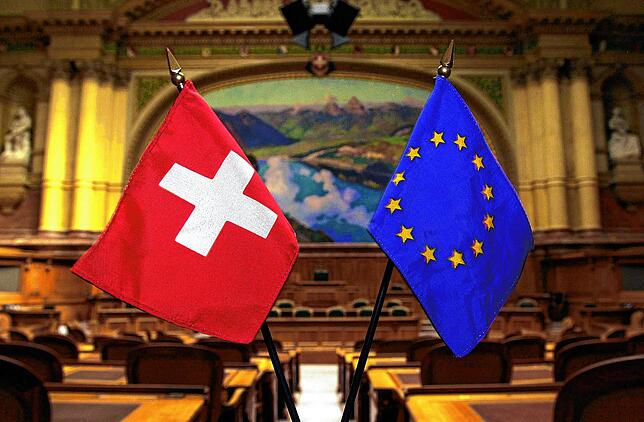
Viele Arbeitnehmer aus der Region, entscheiden sich nach ihrer Ausbildung in Deutschland in der Schweiz zu arbeiten oder ziehen sogar dorthin. Ist das immer eine gute Wahl?
Bliestle: Die Schweiz ist ein wunderschönes Land, kein Zweifel. Ich glaube trotzdem, dass sich einige von den offenkundig höheren Gehältern in der Schweiz und den niedrigen Steuern blenden lassen. Auf der anderen Seite der Waagschale liegen nämlich aus Arbeitnehmersicht deutlich höhere Arbeitszeiten und ein viel schlechterer Kündigungsschutz. Wenn jemand dort nicht funktioniert, ist er ratz-fatz weg. Was das Atmosphärische angeht, höre ich immer wieder, dass deutsche Arbeitnehmer in der Schweiz auch nach Jahren immer noch „die Deutschen“ bleiben, die man zwar braucht, aber nicht voll integriert.
Klodt-Bußmann: Man darf nicht vergessen, dass die Schweiz zunehmend für Firmen attraktiver wird. Die Schweiz ist als Standort auch für deutsche Unternehmen wieder gefragt. Die Debatte um die geplante Standortneueröffnung von Stihl in der Schweiz hat das noch einmal verdeutlicht.
Wie ausgeprägt ist das Phänomen, dass Unternehmen aus der Region in die Schweiz gehen?
Klodt-Bußmann: Wir sehen vermehrt, dass von deutschen Firmen Niederlassungen in der Schweiz eröffnet werden. Dabei handelt es sich sowohl um Vertriebsstandorte als auch um Produktionswerke. Man merkt ein allgemein steigendes Interesse an dem Thema seitens der Wirtschaft.

Woran liegt die steigende Attraktivität der Schweiz?
Klodt-Bußmann: Unternehmen haben großes Vertrauen in die Stabilität der Schweizer Institutionen und schätzen die Konstanz und Wirtschaftsfreundlichkeit der Politik. Dazu kommen andere Punkte wie eine sehr gute digitale Infrastruktur und funktionierende Verkehrswege.
Bliestle: Das größte Gift für die Wirtschaft ist, wenn das Vertrauen in die Verlässlichkeit der politischen Rahmenbedingungen fehlt. Und in diesem Punkt hat Deutschland derzeit leider nicht viel zu bieten.
Klodt-Bußmann: Unternehmen kommen mit vielem zurecht. Hohe Energiepreise beispielsweise senken zwar die Wettbewerbsfähigkeit, aber wenn der zeitliche Horizont berechenbar ist, kann man sich darauf einstellen. Wenn aber wie bei einem Hürdenlauf immer weitere Hindernisse dazwischengeschoben werden, geht den Firmen irgendwann die Puste aus.
Frau Klodt-Bußmann, Ihr Vorgänger in der Hauptgeschäftsführung, Claudius Marx, hat den Spruch geprägt, dass es beim Blick auf die Deutschlandkarte links unten immer weiß ist. Damit meinte er die unzureichende Anbindung der Region an Schienenwege, Autobahnen und Energieinfrastruktur. Ist Besserung in Sicht?
Klodt-Bußmann: Das sehe ich nicht, obwohl wir seit geraumer Zeit sowohl in Stuttgart als auch in Berlin und Brüssel daran arbeiten. Bei der Gäubahn, der Verbindung von Zürich nach Stuttgart, droht ein jahrelanger Stillstand.
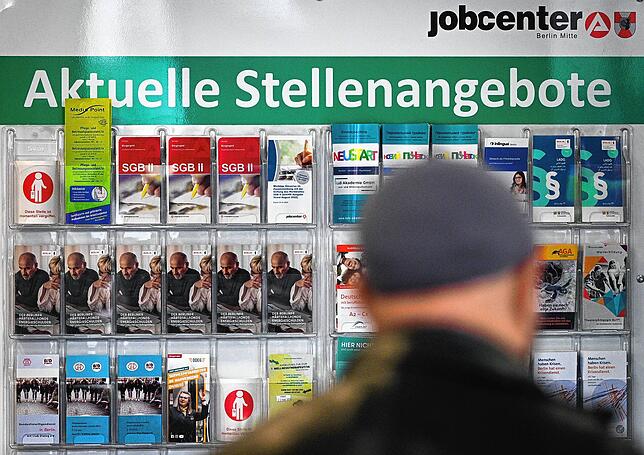
Kommt das Wasserstoffkernnetz bis nach Südbaden?
Klodt-Bußmann: Die bisherigen Planungen sehen eine Verbindung von Frankreich im Westen und vom bayrischen Lindau im Osten sowie möglicherweise einen Zugang von der Schweiz aus vor. Dazu sollen einige Kilometer wasserstofftaugliche Leitung entlang der Grenze kommen. Da fehlt aber bisher der Zulauf. In Summe muss also noch einiges passieren, bevor das Thema Wasserstoff für die Region in trockenen Tüchern ist. Es besteht aber Hoffnung.

Bliestle: Das Kernproblem der Bodensee- und Südschwarzwaldregion ist, dass wir als Wirtschaftsraum komplett unterschätzt werden. Laut der Universität St. Gallen ist die Region unter den zehn stärksten Wirtschaftsregionen in ganz Europa. Das Problem ist nur, dass sich das noch nicht nach Berlin oder Brüssel durchgesprochen hat.
Klodt-Bußmann: Unsere schöne Landschaft, der See und die Berge führen in der Außenwahrnehmung oft dazu, dass wir nur als eine Tourismusregion wahrgenommen werden. Dazu kommt, dass die Betrachtung des Wirtschaftsraums gerne an der Schweizer Grenze endet, die gleichzeitig eine EU-Außengrenze ist. Aber so darf man natürlich nicht denken. Wir sind ein gemeinsamer Wirtschaftsraum und zwar ein sehr starker.







