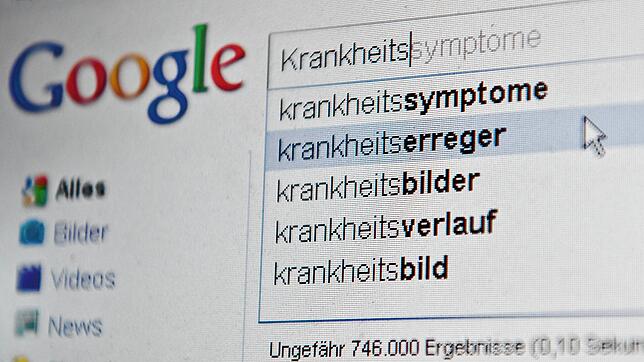Sie sind jung, sehr digitalaffin – und sie gehen mit ihrer Google-Diagnose in die Notaufnahme. Laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2018 suchen 44 Prozent der Menschen zwischen 18 und 39 Jahren am liebsten gleich die Notaufnahme auf, wenn sie Beschwerden haben. „Generation Blaulicht“ werden sie genannt.
Das Problem: Viele von ihnen googeln ihre Symptome, bevor sie sich von einem Arzt untersuchen lassen. Wer selbst schon einmal herausfinden wollte, was hinter den ominösen Kopfschmerzen steckt, gelangt meist auf Internetseiten, die Horrorszenarien prophezeien.
Google hält Hautausschlag für Krätze
Ivo Quack, Leiter der Notaufnahme Konstanz, trifft oft auf genau solche Patienten. Pro Tag kommen zwei bis drei Menschen in die Notaufnahme, die ihre Diagnose von Dr. Google schon dabei haben und das auch explizit erwähnen. „Gerade erst hatte ich eine Patientin mit Hautausschlag, die nach ihrer Google-Recherche nicht davon abzubringen war, dass sie die Krätze hat“, sagt Quack.
Die Therapiemöglichkeiten habe die Frau gleich mitgebracht. Geschickt wurde sie von einer Hausärztin, die die Patientin auch nach dreimaligem Verschreiben einer Kur gegen die Krätzmilben nicht mehr beruhigen konnte.
Generell sei es überraschend, wie gut die Patienten sich häufig eingelesen hätten. „Die Menschen kommen und sagen: Ich brauche auf jeden Fall eine Kernspintomografie, weil ich gelesen habe, dass es das einzige ist, was einen Hirntumor ausschließt“, sagt Ivo Quack.
Kopfschmerzen werden für Tumor gehalten
Einige Krankheitsbilder kommen besonders häufig vor: Aus Kopfschmerz werde sehr schnell eine Hirnhautentzündung, ein Hirntumor oder ein Schlaganfall. Brustschmerz hielten viele für einen Herzinfarkt oder eine Lungenembolie. Und Schmerzen im Bein würden als Thrombose gewertet.
Insgesamt rät Quack davon ab, nach den Krankheitssymptomen zu googeln: „Die meisten werden davon eher alarmiert als beruhigt.“ Welche Krankheit beispielsweise hinter einem Hautausschlag stecke, lasse sich gar nicht mit einer einfachen Google-Suche diagnostizieren. Dazu kommt, dass die Patienten auf Seiten geleitet werden, auf denen die Informationen nicht überprüft werden.
Cyberchondrie entwickelt sich im schlimmsten Fall
Wer nicht aufhören kann, nach seinen Krankheitssymptomen zu googeln, kann unter Umständen eine Cyberchondrie entwickeln. Es handelt sich dabei um eine Art der Hyperchondrie. Wer betroffen ist, hat Angst vor schweren Erkrankungen, was durch zwanghafte Recherchen im Internet und unseriöse Internetseiten verstärkt wird.
Auch in Konstanz hat man das schon erlebt. Nicht immer sei es einfach, die wirkliche Ursache hinter dem Arztbesuch festzustellen. Denn die Betroffenen berichten nur von ihren körperlichen Beschwerden. „Für uns ist dann nur ganz klar, dass es das eben nicht sein kann“, sagt Quack. Er rät dazu, sich offen mit den Ängsten an den Arzt zu wenden.
Künstliche Intelligenz kann Diagnosevorschlag erstellen
Erste Ansätze, wie man tatsächlich im Internet seine Symptome abklären kann, liefert die App eines Berliner Start-ups. „Ada“ arbeitet mit Künstlicher Intelligenz und ist eine Art Online-Symptomchecker. Die Software wurde von Ärzten entwickelt und liefert Patienten einen Diagnosevorschlag, der dann mit einem Arzt besprochen werden kann.
Das könne etwas sein, was in Zukunft besser helfe, sagt Ivo Quack. Doch ein Arztbesuch bleibt trotz Online-Diagnose unverzichtbar.