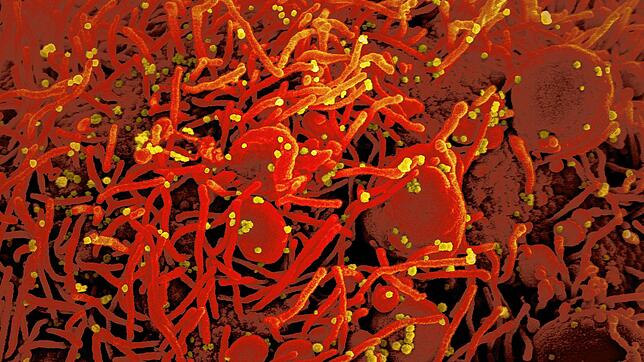Längere Dauer, bis zu 5000 Tote: Zu diesem auf den ersten Blick erschreckenden Ergebnis kommen zwei Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Sie haben mit einem neuen mathematischen Modell den Verlauf einer möglichen zweiten Corona-Pandemiewelle in der Schweiz berechnet.
Doch wie viel länger würde diese zweite Welle dauern? Warum hätte sie so viel mehr Tote zur Folge als die erste Welle, die Anfang März begann und bisher laut dem schweizerischen Bundesamt für Gesundheit rund 1660 Menschenleben gekostet hat? Und lassen sich die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragen? Wir haben bei ETH-Professor Dirk Mohr nachgefragt, der das Modell gemeinsam mit seiner Kollegin Fadoua Balabdaoui errechnet hat.
Wann könnte die zweite Corona-Welle in der Schweiz anrollen und wie lange würde sie dauern?
Der genaue zeitliche Ablauf hänge von der Entwicklung der Reproduktionszahl ab, erklärt Dirk Mohr: „Unser Modell zeigt, dass es im Juni oder Juli beginnen könnte und die zweite Welle dann im September ihren Höhepunkt erreichen würde.“
Je flacher die zweite Welle verlaufe, je langsamer also die Zahl der an Covid-19 Erkrankten ansteige, desto länger werde sie dauern. „Für die meisten Modellszenarien wäre sie Ende des Jahres vorüber, also nach rund sechs Monaten. Damit würde sie doppelt so lange dauern wie die erste.“ Allerdings hätten sie in ihrem Modell die möglichen Auswirkungen der Sommerferien nicht mitberücksichtigt, betont Mohr.
Wie kam die Modellberechnung von Dirk Mohr und Fadoua Balabdaoui zustande und auf welchen Daten und Annahmen beruht sie?
Warum würde eine zweite Welle viel länger dauern?
„Weil unsere Gesellschaft einen Lernprozess durchgemacht hat und sich heute vorsichtiger verhält als bei Ausbruch der Pandemie Anfang März“, erklärt Dirk Mohr. Deshalb werde die zweite Corona-Welle nicht mit derselben Geschwindigkeit anrollen wie die erste und die Zahl der Erkrankten langsamer ansteigen.
„Falls sie kommt, wird sie deutlich langsamer verlaufen und die Reproduktionszahl wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr so hoch sein wie zu Beginn der ersten Infektionswelle, auch wenn die Zahl über den Wert 1 steigen sollte.“ Dadurch hätten auch Politik und Behörden mehr Zeit, zu reagieren und müssten nicht mehr so hektisch handeln wie Anfang März.
Warum könnte die zweite Corona-Welle mehr Tote fordern?
Die Annahme, dass während einer möglichen zweiten Pandemie-Welle rund 5000 Menschen in der Schweiz sterben, sei eher ein „Worst-Case-Szenario“ in ihrem Modell, betont Dirk Mohr: „Das wäre der Fall, wenn an den Schulen gar keine Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mehr getroffen oder eingehalten würden, die Schüler sich also wie vor dem Corona-Ausbruch Anfang März verhielten.“
Ihre Berechnungen hätten gezeigt, dass die 10- bis 20-Jährigen aufgrund ihres Sozialverhaltens überdurchschnittlich zur Verbreitung des Virus beitragen, da sie viel mehr verschiedene Kontakte pflegen als zum Beispiel die Über-60-Jährigen, so Mohr.
Würden die Schweizer Krankenhäuser an den Rand eines Kollaps stoßen?
Nein, das sei nicht zu erwarten, sagt Dirk Mohr: „Die Krankenhäuser werden nicht so voll sein wie während der ersten Welle, weil die Reproduktionszahl niedriger sein wird.“ Vielmehr würden die Krankenhäuser über längere Zeit hinweg eine moderate Auslastung mit Covid-19-Patienten aufweisen.
„Der prozentuale Anteil derer, die an Covid-19 sterben, wird dabei ähnlich sein wie während der ersten Welle.“ Dass die Krankenhäuser nie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, berge aber auch eine Gefahr, betont Mohr: „Ohne einen Kapazitätsengpass vor Augen nimmt die Bevölkerung steigende Todeszahlen möglicherweise nicht wahr oder ihr fehlt das Verständnis für einschränkende Maßnahmen.“
Was kann getan werden, damit während einer zweiten Welle weniger Menschen sterben?
„Werden die Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln sowohl im öffentlichen Leben, in Betrieben als auch in den Schulen konsequent eingehalten, könnte die Anzahl Toter in der Schweiz von 5000 auf rund 1000 reduziert werden“, sagt Dirk Mohr und zeigt sich optimistisch, dass dies gelingen wird.
Wie sicher sind die Ergebnisse der Modellberechnungen?
Die Veröffentlichung von Dirk Mohr und Fadoua Balabdaoui hat den sogenannt wissenschaftlichen Begutachtungsprozess noch nicht durchlaufen, bei dem andere Experten die Ergebnisse ihrer Kollegen anschauen und prüfen, ob auch wirklich alles Hand und Fuß hat.
„Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass wir mit unserer Berechnung, dass eine zweite Welle länger dauern und eine konstant niedrige Reproduktionszahl aufweisen wird, richtig liegen“, betont Mohr. Sie hätten anhand ihres Modells auch den Verlauf der ersten Welle berechnet und ihr Resultat habe den tatsächlichen Verlauf und die Altersverteilung sehr genau abgebildet.
Sind die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragbar?
Eins zu eins auf andere Länder übertragbar seien ihre Ergebnisse nicht. Aber mit ihrem mathematischen Modell ließen sich auch die Verläufe einer zweiten Pandemie-Welle in anderen Ländern berechnen, versichert Dirk Mohr: „Eine Forschergruppe aus den USA macht das bereits für ihr Land. Neben demografischen Unterschieden gibt es einige länderspezifische Modellparameter, die vom lokalen Gesundheitssystem und den Gewohnheiten der Menschen abhängen.“
Dass diese Ergebnisse der Modellberechnungen keine Rückschlüsse auf den Verlauf einer möglichen zweiten Corona-Welle in Deutschland zulassen, bestätigt auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer: „Dass die Parameter für solche Modelle je nach Land ganz unterschiedlich sein können, sieht man beispielsweise auch daran, dass Länder mit ähnlichen Schutzmaßnahmen wie Deutschland ein ganz anderes Infektionsgeschehen hatten als wir.“
Ist in Deutschland mit einer zweiten Corona-Welle zu rechnen?
Ob in Deutschland eine zweite Corona-Welle drohe, sei derzeit schwer abschätzbar, sagt Martin Stürmer: „Wenn die Ausbrüche wie bisher nur punktuell auftreten und kontrollierbar bleiben, kann eine zweite Welle verhindert werden. Schwierig wird es, wenn sich ein lokales Infektionsgeschehen auf weitere Regionen ausbreitet.“
Generell rechnet Stürmer damit, dass die Ansteckungszahlen in Deutschland ab Herbst wieder leicht ansteigen werden: „Zum einen kommt es dann häufiger zu Erkältungen und die Menschen sind empfänglicher für Krankheitserreger. Zum anderen verlagert sich das Leben immer mehr in beheizte Innenräume, wenn es draußen kälter wird.“
Das müsse aber nicht automatisch zu einer zweiten Corona-Welle führen, betont Stürmer: „Was sich aus den Ergebnissen der Schweizer Modellberechnungen ableiten lässt, ist, dass trotz Lockerungen die Verhaltensregeln zur Eindämmung einer Infektion weiterhin eingehalten werden müssen, um eine zweite Pandemie-Welle zu verhindern oder deren Folgen einzudämmen.“
Es brauche weiterhin einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen und, wo das nicht gehe, müssten Masken getragen werden. „Was geschehen kann, wenn diese Maßnahmen nicht mehr eingehalten werden, zeigt sich derzeit anhand der lokalen Covid-19-Ausbrüche in Göttingen oder Frankfurt„, mahnt Stürmer.