Professor Peter Kremsner hat alle Hände voll zu tun. Ich erwische ihn nach einer Besprechung mit seinen Studienärzten. Der Leiter der klinischen Studie zum neuen Impfstoff gegen Covid-19 an der Uniklinik Tübingen muss gerade einiges organisieren.
Allein in der kommenden Woche seien 30 Probanden zum Impfen eingeplant, jeder von ihnen muss zur Überwachung mehrere Stunden in der Klinik bleiben, es dürfen aber nicht zu viele Menschen in einem Raum warten.
Infektionsschutz gilt auch bei den nachweislich gesunden Probanden, die einen Coronatest abgeben müssen, der nicht älter als zwei Tage sein darf, um an der Studie teilnehmen zu dürfen. Die Impfstudie soll einen neuen Impfstoff gegen den neuen Coronaerreger zur Zulassung verhelfen. Die Zeit drängt – denn Experten schließen eine zweite Welle der Pandemie nicht aus. Für mich ist es etwas Besonderes, Teil davon zu sein.
Kontrolle nach der Impfung
Der Weg zum Tropeninstitut nach Tübingen ist fast schon Routine: Ich bin zum zweiten Kontrolltermin nach meiner Impfung da. Meine Ärztin ist heute Eva-Maria Neurohr. Die Internistin untersucht mich gründlich, misst nicht nur Puls und Temperatur, sondern tastet auch auf Lymphknoten ab, den Bauch und den Rücken, hört Lunge und Herz ab. Einen ganzen Fragebogen zu möglichen Symptomen geht sie erneut mit mir durch – doch mir fehlt nichts, es geht mir gut.
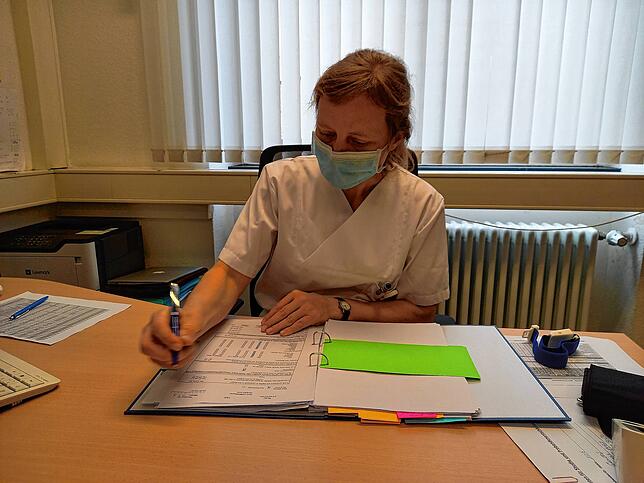
Jetzt geht es ans Eingemachte: Ich muss mehrere Blutproben abgeben, die mit dem sogenannten Elisa-System auf Antikörper geprüft werden. Zusätzlich wird zur Überprüfung meiner Werte ein Blutbild erstellt, um sicherzugehen, dass alles im grünen Bereich ist. Die Werte werden mit den Ergebnissen der Voruntersuchung verglichen.
Was sagen die Blutwerte?
Die Blutwerte der ersten Kontrolle liegen schon vor: Sie sind normal, keine Besonderheiten. Ich atme auf. Die Antikörper-Frage, die mich am brennendsten interessiert, kann mir Neurohr aber nicht beantworten: Denn ich gehöre zur sogenannten „verblindeten“ Gruppe.
Ob ich tatsächlich geimpft wurde, oder nur ein Placebo bekam, werde ich erst am Ende der Studie erfahren. „Das heißt, dass auch erst dann Resultate zugeordnet werden können“, erklärt Neurohr. Die Auswertungen liegen den Laboren natürlich schon vorher vor.
Professor Kremsner könnte als Studienleiter jederzeit „entblinden“, also einsehen, ob ein Patient geimpft wurde oder nicht. „Aber das mache ich nur, wenn es aus medizinischer Sicht notwendig ist“, erklärt er. Ich muss mich also gedulden.
Studie verläuft bislang wie geplant
Aber auch für Kremsner ist der Prozess spannend: „Die heiße Phase sind natürlich die ersten beiden Monate“, sagt er. Körperliche Reaktionen seien aber ohnehin erst 14 Tage nach der Impfung messbar. Deutlichere Reaktionen erwartet der Studienleiter nach der zweiten Impfung, die für mich noch bevorsteht.

Bislang ist Kremsner zufrieden mit dem Studienverlauf: „Es ist alles im grünen Bereich“, sagt er – genauer darf er nicht werden. Inzwischen ist die Dosis für die Probanden schon erhöht worden – von zwei Mikrogramm auf vier und schließlich auf sechs Mikrogramm. Am Wochenende soll die unabhängige Ethikkommission darüber entscheiden, ob die Dosis auf acht Mikrogramm erhöht wird – die maximal vorgesehene Menge.
Mehr Probanden als nötig – und doch zu wenige
Potenzielle Probanden bewerben sich seit dem Rundbrief, den das Tropeninstitut an der Uniklinik verschickte, genug. Mehr als 4000 Leute wollten mitmachen, erzählt Kremsner. So einen großen Ansturm kennt Kremsner sonst nicht. Normalerweise sei es schwieriger, Probanden zu gewinnen. Die meisten der Bewerber seien allerdings unter 40 Jahren.
Das ist ein Problem: Denn die Hälfte der Probanden müssen nach den Vorgaben der Studie über 40 und unter 60 Jahren sein. „Das ist außergewöhnlich für die erste Phase der klinischen Studie“, sagt Kremsner. Normalerweise werde mit den jüngeren Probanden begonnen. Insgesamt sollen 168 Probanden geimpft werden – neben Tübingen werden dann auch im belgischen Gent, später auch in Hannover und in München Probanden geimpft.
In diesem Fall gehe es aber darum, „dass wir uns schnell an die Zielgruppe herantasten, das sind eigentlich die über 65-Jährigen“, erläutert der Professor. Denn erst ab diesem Alter wird die Krankheit nach den bisherigen medizinischen Erkenntnissen wirklich riskant.
In der nächsten Phase will Kremsner deshalb auch über 60-Jährige als Probanden aufnehmen. Wann genau das möglich sein wird, ist noch nicht klar: Kremsner rechnet aber damit, dass diese Probanden in den nächsten Wochen oder Monaten geimpft werden können.
Doch schon jetzt hat das Tropeninstitut Mühe, ausreichend Probanden über 40 zu bekommen, die geeignet sind. Wer teilnehmen will, darf keinerlei Vorerkrankungen haben, keine Allergien, keine Diabetes, keinen Herzfehler. Wer nicht kerngesund ist, wird sozusagen ausgemustert.
Die Folge: „Etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Probanden passen gesundheitlich nicht in die Studie“, schätzt Kremsner. Sie litten etwa an Bluthochdruck, Prädiabetes oder „was man so kriegt mit den Jahren“, sagt der Arzt. Bis 60 kerngesund sein, das sei schon eine Leistung, macht er das Problem deutlich.
Spannende Phase steht noch bevor
Kremsner geht das alles nicht schnell genug. Er will so bald als möglich mit der nächsten Phase beginnen. Doch zunächst muss die erste Phase erfolgreich abgeschlossen werden. In Phase Zwei sollen dann deutlich mehr Probanden teilnehmen. Darin werden die finale Dosis festgelegt und die Wirksamkeit geprüft – allerdings nicht im Körper, sondern in vitro. Es werden also lediglich Körperzellen entnommen und in vitro, also im Reagenzglas, mit Viren konfrontiert.
Erst in der dritten Phase sollen Menschen dem Virus ausgesetzt werden. Kremsner hat gemeinsam mit anderen Kollegen ein Modell erarbeitet, wie diese letzte Phase aussehen könnte, die für die Zulassung des Impfstoffs entscheidend ist.







