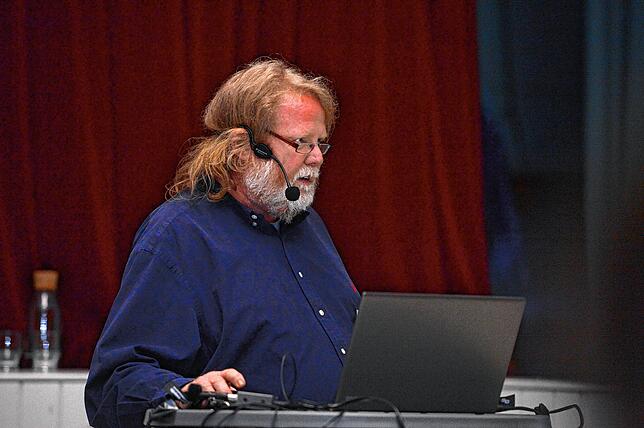„Blick in die Werkstatt“ lautete das Motto der beiden Informationsveranstaltungen des Regierungspräsidiums Tübingen in Immenstaad. Umweltgutachter Burchard Stocks führte die Besucher durch mehr als 80 Folien, die unter anderem Informationen zur geologischen Erkundung, Verkehrs-, Lärm- und Luftschadstoffuntersuchung beinhalteten. Insbesondere die geologische Erkundung mit Probebohrungen in diesem Sommer hatte vielen Bürgern die B-31-neu-Planung für den Abschnitt Immenstaad-Meersburg auch optisch vergegenwärtigt.
- Geologische Erkundung: Zuständig sind das Ingenieurbüro Smoltczyk und Partner aus Stuttgart sowie das Sachgebiet Straßenbau- und Geotechnik im Regierungspräsidium. Ihr Ziel ist es, die Varianten bezüglich der geotechnischen Machbarkeit und notwendigen Aufwendung für Bau und Unterhaltung zu bewerten. Dafür wurden vorhandene Unterlagen wie zum Beispiel geologische Karten einbezogen. Laut Definition stellen diese die Oberfläche und/oder den oberflächennahen Untergrund dar.

Das Planungsgebiet ist eiszeitlich geprägt, durch Schmelzwasser wurden Schotter und Sande abgelagert, Gletscher hinterließen Geschiebemergel und Gletscherseen Beckensedimente. Geschiebemergel kann Ton, Schluff, Sand, Kies, Steine und Findlinge enthalten.
Untersuchungen an 22 Bohrstellen
Auch in den Beckensedimenten finden sich verschiedene Materialschichten. Zu den Betrachtungen kamen die gezielten Bohrungen zur Erkundung von Schichtaufbau und Grundwasser dazu. Nach Angaben des Regierungspräsidiums waren es 22 Bohrstellen auf den Gemarkungen Meersburg, Stetten, Hagnau, Markdorf, Ittendorf, Kippenhausen und Immenstaad.

Insgesamt wurden 460 Bohrmeter in die Tiefe getrieben und die Grundwassermessstellen ausgebaut. Die Bodenproben kamen schließlich ins Labor. Umweltgutachter Burchard Stocks fasste die Ergebnisse zusammen: Im Grunde konnte das Bild, das sich die Experten mithilfe der geologischen Karten gemacht hatten, durch die Erkundungsbohrungen bestätigt werden.
Aus geotechnischer Sicht sind alle Varianten potenziell realisierbar. Als Beispiel zog Stocks die Tunnelbauten heran, die bei Hagnau vorgesehen sind. Mit einem Bohrkopf könnten diese realisiert werden. Von den Geologen sei kein Mehraufwand spezifiziert worden, sagte der Umweltgutachter. Nur in der bestehenden Trasse gebe es Kies und anderes. Für die Geologen steht nun die Abwägung hinsichtlich des technischen Aufwands der Trassen an.
- Verkehrsuntersuchung: Für die Verkehrsuntersuchung wurde die Modus Consult GmbH in Ulm beauftragt. Sie hat ihren Überlegungen verschiedene Annahmen zugrunde gelegt: den Analyse-Nullfall 2016, eine Abbildung des Ist-Zustandes mit Zählungen und Befragungen aus dem Jahr 2016 im damals bestehenden Straßennetz; den Prognose-Nullfall 2035 mit Berechnung des zukünftigen Verkehrsaufkommens; den Prognose-Bezugsfall 2035, ebenfalls mit Berechnung des zukünftigen Verkehrsaufkommens, aber beispielsweise einer Reduzierung von Kraftfahrzeugen; sowie die Prognose-Planfälle 2035, die die Auswirkungen der einzelnen Trassenvarianten bei einem vierspurigen Aus- oder Neubau beinhalten.
„Die Verhältnisse sind immer irgendwo ähnlich“, wie Umweltgutachter Burchard Stocks darlegte. Ein Beispiel: Wird sich für den Ausbau der bestehenden Bundesstraße 31 entschieden und geht man insgesamt von einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens aus, also dem Prognose-Bezugsfall 2035, profitiert die Ortsdurchfahrt Stetten beziehungsweise B 33. Dann wird die Zahl der Kraftfahrzeuge dort von 12 600 auf 11 200 pro 24 Stunden sinken und anstatt 14 werden anteilig 13 Prozent Schwerlastverkehr verzeichnet.

Maximal fällt der Effekt jedoch auf der Ortsdurchfahrt Hagnau aus: mit 2400 Kraftfahrzeugen und vier Prozent Schwerlastverkehr im Vergleich zu 22 400 Kraftfahrzeugen und 18 Prozent Schwerlastverkehr. Einige hundert Kraftfahrzeuge mehr fallen an der Ortsdurchfahrt Meersburg (insgesamt 13 500, Zunahme von 200 pro 24 Stunden) und auf der L 207 bei Immenstaad an (insgesamt 5800, Zunahme von 300). Letzteres weil die Verknüpfung zwischen Landesstraße und B 31-neu nicht mehr vorgesehen ist.
Szenarien mit Gewinnern und Verlierern
Ein anderes Szenario: Wird die Variante B 2 mit südlicher Umfahrung von Stetten und Rückführung auf den Bestand bei Immenstaad realisiert, gehört die Gemeinde Stetten zu den großen Gewinnern: mit täglich 11 000 Kraftfahrzeugen weniger. Ebenfalls die Ortsdurchfahrt Hagnau profitiert. Denn die Belastung nimmt um 19 100 Kraftfahrzeuge pro 24 Stunden ab.
Eine Steigerung gibt es dagegen wieder in Meersburg: um 100 Kraftfahrzeuge. Ein weiteres Beispiel: Kommt die Variante C 1.1 zur Geltung mit nördlicher Umfahrung von Stetten, Parallelführung der B 31-neu und B 33 sowie Querung L 207/Lipbach nördlich von Immenstaad, haben – sofern es um die Verkehrsentwicklung geht – nur Hagnau, Kluftern und Markdorf etwas davon.
Mit welchem Verkehrsaufkommen kalkuliert?
Mehr Verkehr wird in Stetten (plus 300 Kraftfahrzeuge pro Tag), Meersburg (plus 400 Kraftfahrzeuge) und auf der L 207 erwartet (plus 7900 Kraftfahrzeuge). Die untersuchten Trassenvarianten übernehmen durchschnittlich ein Verkehrsaufkommen von 25 200 bis 29 800 Kraftfahrzeuge mit einem Anteil von 15 bis 26 Prozent Schwerlastverkehr.
- Lärmuntersuchung: An dem Gutachten zur Lärmentwicklung sind das Regierungspräsidium sowie Klinger und Partner, Ingenieurbüro für Bauwesen und Umwelttechnik aus Stuttgart, beteiligt. Ermittelt wurden der Mittelungspegel, dabei handelt es sich um den Dauerschallpegel, und der Emissionspegel, der die freie Schallausbreitung bezeichnet. Der Beurteilungszeitraum erstreckte sich von tagsüber, 6 bis 22 Uhr, bis nachts, 22 bis 6 Uhr. In den Mittelungspegel fließen Faktoren wie die Verkehrsstärke, der Anteil von Lastwagen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, Geschwindigkeit, Straßenoberfläche, topografische und bauliche Gegebenheiten sowie Abschirmung durch Wände, Wälle und Gebäude ein.
Als Faustformel gilt nach Angaben der Experten, dass eine Pegeländerung ab drei dB(A) für das menschliche Ohr wahrnehmbar ist. Eine Pegelveränderung von plus oder minus zehn dB(A) wird als Verdoppelung oder Halbierung des Lärms empfunden. Eine Verdoppelung des Abstands zur Lärmquelle erbringt eine Pegelminderung von vier dB(A). Ein normales Gespräch zwischen 6 und 22 Uhr in einem Wohngebiet darf nach Bundesimmissionsschutzverordnung zum Beispiel knapp 60 dB(A) erreichen.
Diese Maßnahmen gibt es bei Überschreitungen
Zum Lärmschutz werden die Beurteilungspegel mit den Grenzwerten verglichen. Bei Überschreitung besteht der Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen. Umweltgutachter Burchard Stocks zufolge hat der aktive Lärmschutz mit Schallschutzwänden und anderen Maßnahmen Vorrang vor dem passiven Lärmschutz. Bei Letzterem handelt es sich etwa um lärmdämmende Fenster. Mithilfe von Lärmkarten demonstrierte Stocks die Berechnungen. „Ich hoffe, ich kann Ihnen etwas vermitteln“, schickte er voraus. Die zu erwartenden Pegelveränderungen sind in verschiedenen Farben darauf vermerkt, teils bereits Lärmschutzmaßnahmen eingezeichnet.
Lärmanstieg von bis zu neun dB(A) tagsüber
Am auffälligsten ist die Lärmentwicklung im Falle der Hinterlandtrasse C 1.1. Die Bereiche um die Trasse sind rot bis hellbraun eingefärbt für einen Lärmanstieg von bis zu neun dB(A) tagsüber. Direkt betroffen ist beispielsweise Stetten, weil die Variante eine nördliche Umfahrung der Gemeinde vorbei am Roggele vorsieht. Auch verläuft sie deutlich näher am Immenstaader Siedlungsrand, nachdem sie von den Planern „konkretisiert“ wurde. Stocks nimmt an, dass die Trasse hier nur mit einer Überdeckelung funktioniert. Insbesondere Hagnau profitiert jedoch von einer Lärmreduzierung von bis zu neun dB(A).
Auswirkungen auf Mensch und Tier
Doch nicht nur der Mensch zählt beim Lärmschutz. „Es gibt in den Waldbereichen eine Vielzahl an störungsempfindlichen Arten“, berichtete Stocks. Schallschutzmaßnahmen sind daher ebenso im Artenschutz möglich. Interessant ist: Kollisionsschutz für Fledermäuse kann nach Angaben Stocks‚ „Lärmschutzmaßnahmen übernehmen“. Im Variantenvergleich sollen die Ergebnisse nun differenziert betrachtet werden.
- Luftschadstoffuntersuchung: Zuständig ist das Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH und Co. KG in Karlsruhe und Dresden. Noch ist das Gutachten nicht fertiggestellt. Bestimmt werden die verkehrsbedingten Emissionen für Stickoxide und Feinstaub. Grundlage ist nach Angaben von Umweltgutachter Burchard Stocks die Emissionsdatenbank des Umweltbundesamtes. Beeinflusst werden die Werte von den Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet. Damit ist zum Beispiel das Bodenrelief gemeint. Eingangsdaten für die Berechnungen sind die Prognosen für das Verkehrsaufkommen, die Lagen der Trassen und Lärmschutzbauten sowie die Lagen und Längen der Tunnelbauwerke. Ermittelt werden daraus Vorhersagen für die Luftschadstoffemissionen.
Entscheidend sei der NO2-Jahresmittelwert, sagte Stocks. Bei NO2 handelt es sich um Stickstoffdioxid, ein schädliches Gas und Vorläufer für die Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon, wie auf der Internetseite des Umweltbundesamtes zu lesen ist. Der Jahresmittelwert beziehungsweise Langzeitwert für Stickstoffdioxid liegt draußen bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Stocks erklärte, dass sich die erste Betrachtung auf diesen Wert beschränke.
Wie geht es jetzt weiter?
Als Beispiel hatte er Karten von der Ausbauvariante dabei. Im Planfall A wird die Ortsdurchfahrt Hagnau zwar „deutlich“ entlastet, so Stocks. Dort, wo Knotenpunkte und Tunnelbauten sind, ist allerdings mit Erhöhungen zu rechnen. Als nächstes werden die weiteren Varianten und verkehrsbedingten Stickstoffeinträge in geschützte Vegetationsbereiche untersucht.