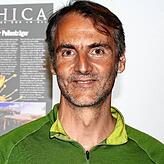Wenn die Überlinger Waldrappe wüssten, wie oft sie schon in der Zeitung standen. Mal ging es um süße Küken, anderntags um den Mord an einen Artgenossen. Zuletzt nannte die „Bild“ sie die ‚dümmsten Vögel Deutschlands‘. Doch im Gegenteil: Die Nachzügler vom Bodensee gingen damit einem Zyklon in Italien aus dem Weg und überlebten, während 27 Waldrappe anderer Populationen dabei starben.
Das Waldrapp-Projekt hat in den vergangenen fünf Jahren emotionale und tragische Geschichten hervorgebracht. Dabei gerät aber in den Hintergrund, dass mittlerweile eine stabile Population aus 39 Vögeln existiert. Zu Beginn Ende 2017 waren es noch 19.
Höhepunkte und Herausforderungen
Trotz des Wachstums hat Projektleiter Johannes Fritz die Herausforderungen der vergangenen fünf Jahre nicht vergessen. Zwar sei es ein Höhepunkt gewesen, Zugvögel aus künstlicher Brut in die Population überzusiedeln. Ihn habe es auch gefreut, dass sich so viele Menschen in der Region für die Tiere begeistern.
„Der Klimawandel und die Auswirkungen auf die Tiere bereiteten mir aber zunehmend Sorgen“, sagt er. Im Herbst bewegten sich die Tiere immer später in den Süden und kämen wegen mangelnder Thermik in den Alpen oft nicht über die Berge. Zuletzt mussten sie in Kartons mit dem Auto erneut über die Alpen gefahren werden.
Könnten die Tiere am Bodensee überwintern?
Die Zugvögel am Bodensee überwintern zu lassen, sei laut Fritz vorerst nicht geplant. Dass das möglich aber wäre, zeigen Weißstörche am Affenberg in Salem. Einige von ihnen ziehen im Winter gar nicht mehr gen Süden – oder nur kürzere Strecken, wie Direktor und Zoologe Roland Hilgartner erklärt. „Ich gehe davon aus, dass der Klimawandel eine maßgebliche Rolle spielt.“
Weißstörche und Waldrappen ließen sich aber nur bedingt vergleichen, so Hilgartner. Bei Störchen ist der Zugtrieb angeboren, junge Waldrappen müssten von ihren Eltern nach Süden gelotst werden.
Beim Projekt „sollte man nicht aufs Geld schauen“
Ornithologe Peter Berthold holte das Projekt einst an den Bodensee. Er hält es für möglich, dass die Waldrappen künftig in Überlingen überwintern. „Das kann dazu führen, dass sie gefüttert werden müssen.“ Die Zeit bis dahin könne aber kritisch werden, da sich das Problem mit dem Alpenflug kaum löse, so der Forscher aus Herdwangen-Schönach.
Insgesamt sieht Berthold den Verlauf des Waldrappen-Projekts „sehr positiv“, wie er sagt. Obwohl es seit 2017 mehr als eine halbe Million Euro gekostet habe, habe sich die Arbeit gelohnt. Das Geld stammt aus einem EU-Umweltfonds. „Jede Tierart auf der Welt ist einzigartig und unersetzlich. Wir sind nicht in der Lage, eine Tierart wiederherzustellen.“ Die Waldrappen seien wichtig für das Ökosystem. „Da sollte man nicht aufs Geld schauen“, sagt der ehemalige Leiter des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell.
Waldrappen nicht mehr auf Roter Liste
Ein wenig Stolz über die Arbeit von ihm und seinem Team lässt sich auch Projektleiter Josef Fritz entlocken. „Die Mühe und Arbeit hat sich gelohnt“, sagt Projektleiter Johannes Fritz. „Unsere Modellierungen zeigen, dass es eine realistische Chance gibt, die Population zu erhalten.“
Wenn das gelänge, wäre es die erste Wiederansiedlung einer Zugvogelart überhaupt. 1994 war der Waldrappe noch auf der Roten Liste. 2018 wurde er zurückgestuft. „Unsere Arbeit kann man jetzt schon als Erfolg verbuchen.“
Wie geht es weiter?
Bis 2028 soll die Population in Überlingen eigenständig überleben können. Im Jahr 2023 wird das Überlinger Team erstmal wieder eine Gruppe Jungvögel für die Kolonie Überlingen aufziehen, mit ihnen in das Wintergebiet fliegen und sie dort auswildern, so Fritz. „Damit sollten wir wieder deutlich über eine Zahl von 42 Vögeln für die Kolonie kommen.“