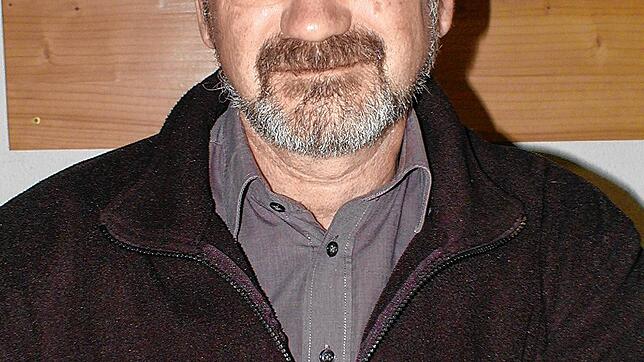Wie groß waren die Schäden im Bad Säckinger Stadtwald?
In wenigen Minuten fallen rund 34.000 Festmeter Sturmholz an. In der Kernzone des Orkans, am Winkeln-Weg und Kleemättle wurden Althölzer zu achtzig Prozent geworfen. Unterhalb vom Seeblick walzte die Naturgewalt eine drei Hektar große Fläche nieder. Zehn Hektar Fichtenaltholz fielen östlich des Eggbergsenders dem Sturm zum Opfer. Zahlreiche Flächen-, Nester- und Einzelwürfe im Randbereich kamen dazu.
Der Jahrhundertsturm veränderte auch die Rickenbacher Waldlandschaft, in der Christian Kiefer zehn Hektar Fichtenwald besaß, gewaltig. Das Sturmtief verursachte über 35.000 Kubikmeter Schadholz. Flächenhafte Schäden betrafen den Maisenhardt- und den Beuggenwald zwischen Egg, Willaringen und Schweikhof. Hier war die Straße auf der Länge von zwei Kilometern komplett mit mehreren tausend Festmetern Sturmholz blockiert und wochenlang unpassierbar.
Außerdem zeigten die Waldflächen an der westlichen Gefällbruchkante zwischen Bergalingen und Hütten, zwischen Bergalingen, Rickenbach und Hottingen zum Hoheneck und die südwestlich ausgerichteten Flächen im Gewann „Abhau“ über Altenschwand einen hohen Verwüstungsgrad.

Der damalige Forstdirektor erinnert sich
Forstdirektor Hans Mehlin war zum Zeitpunkt des Orkans Lothar Leiter des Forstbezirkes West. Für den Forstmeister bleibt dieses Ereignis unvergesslich. Mehlin erinnert sich, mit welchen Problembereichen die Waldbesitzer und das Forstamt zu kämpfen hatte. Eine Geschichte zeigt besonders, mit welcher Wucht der Sturm getobt hat: Auf dem Günnebacher Straße war ein Autofahrer mit einem BMW auf dem Weg zur Arbeit eingeschlossen worden. Er ließ das Auto und seinen Lap-Top zurück. Dann turnte er über das Sturmholz bis in die „sicheren Gebiete“. Er musste über zwei Wochen warten, bis der Günnebacher Weg geräumt werden konnte. Denn wurden die öffentlichen Straßen vom Sturmholz befreit.
Der wirtschaftliche Schaden
Über Jahrzehnte pflegt der Waldbesitzer seinen Baumbestand. Er ist Sparkasse, Wertanlage, Brennholzlieferant oder jederzeit abrufbare Geldquelle. Die Waldbewirtschaftung ist auf Jahrzehnte angelegt. Bei einem so heftigen Sturm wird das gesamte Kapital in wenigen Sekunden vernichtet. Aufgrund des Massenanfalls von Schadholz sank der Preis von vormals 180 DM auf 60 DM.
Aufarbeitung des Holzes
Um das Holz vor Qualitätsverlust zu schützen, musste es sofort aufgearbeitet werden. Alleine ist der Waldbesitzer überfordert, da er nicht über die dazu nötigen Forstausrüstung, einschließlich der Maschinen, verfügt. Außerdem fehlt die nötige Erfahrung im Umgang mit unter Spannung stehenden Bäumen. Da aufgrund des enormen Sturmholzanfalles zur Aufarbeitung nicht genügend heimische Fachkräfte zur Verfügung standen, unterstützten auswärtige Forstunternehmen die heimischen Holzfacharbeiter.
Menschen in Not zu helfen, die Hauptverbindungsstraßen wieder befahrbar zu machen und die Stromversorgung wiederherzustellen, war die vordringliche Aufgabe des technischen Hilfswerkes, der Feuerwehr, der Energieunternehmen, der Gemeinden und des Forstes.
Doch gerade die Feuerwehr stieß bei den Aufräumarbeiten aufgrund der Gefahrensituation, die von Sturmholz ausgeht, an ihre Grenzen.
Übereinanderliegende und unter Spannung stehende Baumstämme waren selbst für die Profis eine lebensgefährliche Arbeit und für den Laienhelfer kaum zu bewältigen.
Die schwierige Vermarktung
Zur Marktentlastung zugunsten der Waldbesitzer wurden bis zum Jahr 2003 rund 10.000 Festmeter Holz aus dem Rickenbacher Wald im zentralen Nassberieselungslager in Hottingen gelagert. Im Rüttmättli und am Bergsee wurde städtisches Holz von Bad Säckingen berieselt. Von April bis Oktober wurden wöchentlich zwei Schiffe beladen. Das Fassungsvermögen eines Schiffes betrug 3500 Festmeter. Für das zuständige Forstamt und dessen Mitarbeiter, den Förstern vor Ort, war es eine logistische Herausforderung, bis 160.000 Festmeter Lotharholz mit Lastwagen, Bahn und Schiffen in weit entfernte Sägewerke abtransportiert waren. Mehlin weiß noch heute das Engagement der Revierförster zu schätzen, wenn er feststellt: „Sie haben sich bis zur Belastungsgrenze eingesetzt, dass die Aufarbeitung und der Abtransport funktionierte“.
Die Folgeschäden
Borkenkäferbefall, kleine Stürme und die trockenen Sommer in den Jahren 2003 bis 2005 schadeten dem Wald erheblich. Die heißen Sommer führten zu einer Massenvermehrung der Population der Borkenkäfer. Sie brachte im Rickenbacher Wald zwischen den Jahren 2001 und 2006 weitere 42 000 Festmeter Fichte zum Absterben.
Das Konzept der Erneuerung
Als Konsequenz aus dem Sturmereignissen Wiebke (1990) und Lothar (1999) und der Borkenkäferplage fordert Mehlin als Ziel der Waldbewirtschaftung den Aufbau und die Pflege naturnaher, standortgerechter und stabiler Wälder. Dazu gehören eine angemessene Beteiligung von Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft (Tanne, Buche, Eiche, Esche, Bergahorn, Linde und Erle), sowie eine gezielte Pflege in Richtung Mischwälder.
Dies erfordert einen Umbau von Reinbeständen hin zu Mischwäldern. Dadurch werden Struktur und Stabilität in den Wäldern verbessert. Der Wald muss insbesondere den neuen klimatischen Herausforderungen angepasst werden. Die ist dringend notwendig, da neue Klimamodelle bis zum Jahre 2040 eine Erderwärmung bis zu vier Grad Celsius prognostizieren.