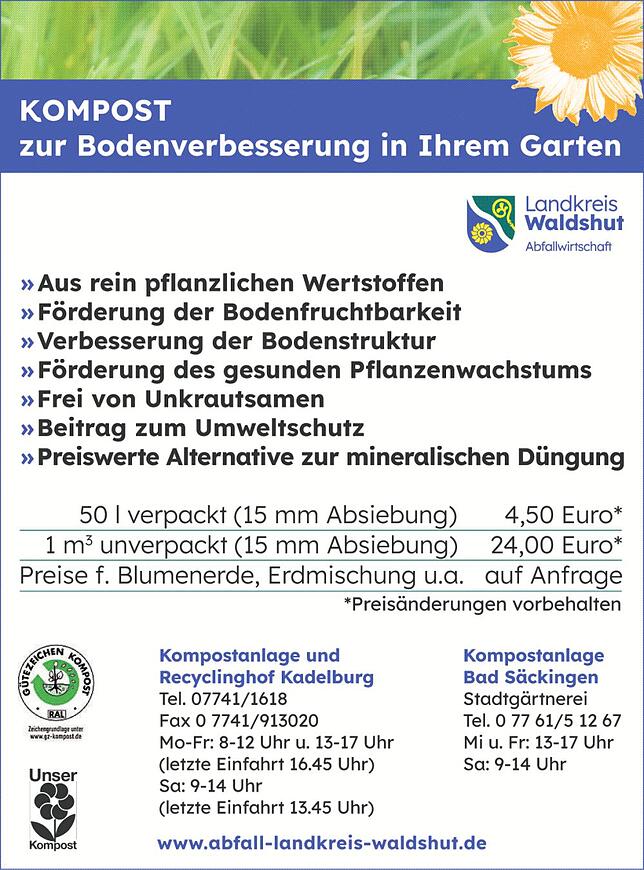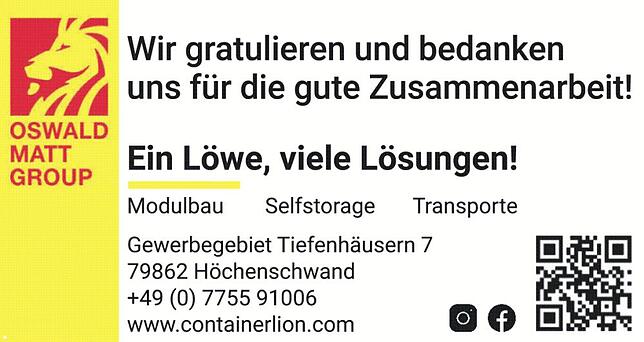Höchenschwand (pic) Die Gemeinde Höchenschwand hat sich trotz der Krisen stetig weiterentwickelt. Dies zeigen auch die Einwohnerzahlen, die aktuell bei 2780 Bürgerinnen und Bürger liegen. Dieser positive Effekt bedeutete aber auch Herausforderungen für die Gemeinde, denn sie musste mehr Anstrengungen bei der Betreuung der Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Verlassen der Grundschule unternehmen. So bietet Höchenschwand eine Kinderkrippe mit 20 Plätzen und einen Kindergarten mit 105 Plätzen an. In der „verlässlichen Grundschule“ werden aktuell 45 Kinder betreut. Hier wird man in den kommenden Jahren auch die Ganztagsbetreuung einführen.
Der Bedarf an Ausrüstung für die Feuerwehr wächst stetig. So wurde in den letzten zehn Jahren neben einer neuen Drehleiter in weitere Fahrzeuge und Ausrüstung investiert. Die Arbeiten, die durch das Bauhofteam erledigt werden müssen, nehmen stetig zu, auch das führte zu fortlaufenden Investitionen in die Infrastruktur.
Seit 2018 hat die Gemeinde drei Straßen inklusive Wasser- und Abwasserleitungen im Wert von rund 3,5 Millionen Euro komplett saniert. Darüber hinaus werden Baugebiete entwickelt, was wiederum dazu führte, dass auch die Abwasserbeseitigung ausgebaut werden musste und die Gemeinde in den Bau der Kläranlage Heppenschwand über vier Millionen Euro investierte.
Schnell hat man auch in der Ukrainer-Krise reagiert und nahezu direkt nach Kriegsbeginn sofort Hilfeleistungen gestartet und Flüchtlinge in der Gemeinde aufgenommen.
Hervorzuheben sind auch die beiden neuen Vereine, welche sich in den letzten Jahren gründeten. Der Nachbarschaftshilfeverein bietet seit ein paar Jahren viele Leistungen für bedürftige und ältere Menschen an. Eine inzwischen nicht mehr wegzudenkende Hilfe für die Menschen in der Gemeinde Höchenschwand. Das fasnächtliche Leben wird seit einigen Jahren durch die neu gegründeten „Geisterbäumlehexen“ vom Unterberg mitgestaltet.
„Ich bin überzeugt, dass sich unsere Gemeinde positiv weiterentwickeln wird. Die Herausforderungen werden aber sicher nicht weniger“, so Sebastian Stiegeler, der seit 2019 Bürgermeister im „Dorf am Himmel“ ist. Aufgrund des Klimawandels werde Höchenschwand touristisch, als Kurort aber auch als Wohnort attraktiv bleiben. Dem trägt die Gemeinde Rechnung. So will sie beispielsweise, die beliebte Veranstaltungsstätte „Haus des Gastes“ aufwerten und den Außenbereich sanieren. Da aktuell alle Gewerbeflächen vergeben sind, sollen weitere Gewerbegebiete ausgewiesen werden. Um die Nachfrage nach Wohnraum zu decken, sollen weitere Bauplätze erschlossen werden. Zudem wird das aktuell im Bau befindliche neue Ärztehaus für eine Belebung der Ortsmitte sorgen und die ärztliche Versorgung der Einwohner, aber auch der Region wesentlich verbessern.
„Ich bin überzeugt, dass sich unsere Gemeinde positiv weiterentwickeln wird.“
Sebastian Stiegeler,
Bürgermeister
Vom Bergdorf zum heilklimatischen Kurort
Höchenschwand – Die Gemeinde Höchenschwand konnte am 1. Oktober auf 50 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Nachdem es viele Jahrzehnte nur aufwärtsging, hatte die Kurkrise in den 90iger Jahren dramatisch Auswirkungen auf die Entwicklung des Ortes. Die Gemeinde konnte aber gegensteuern, sodass zwischenzeitlich wieder eine positive Stimmung im Ort festzustellen ist.
- Das Jubiläum soll im Rahmen des Neujahrsempfanges der Gemeinde am 12. Januar 2025 in einem würdigen Rahmen gefeiert werden.
Ab 1871 erlebte Höchenschwand einen deutlichen Aufschwung seiner Entwicklung. In dieser Zeit liegen die Anfänge der stetigen Umstellung vom kleinen Bergbauerndörfchen zum späteren heilklimatischen Kurort. Den eigentlichen Startschuss für den späteren Fremdenverkehr gab 1873 Augustin Maier. Dieser wirtete zuerst auf dem Feldberg, erwarb dann den „Ochsen“ in Höchenschwand und baute ihn 1873 um. Aus dem Gasthof wurde 1895 das „Kurhaus Höchenschwand“. Damit war der Begriff „Kur“ gegeben, zumal das Haus am 1. Juli 1919 eine ärztliche Abteilung unter der Leitung von Dr. med. Wilhelm Bettinger erhielt. 1925 trat Hotelier Bernhard Porten in die Kurhaus-GmbH ein und übernahm 1932 deren Leitung.
Das erste Werk der beiden war 1934 die Gründung der Augenheilstätte „Sonnenhof“, der ersten dieser Art in Deutschland. Am 10. November 1939 wurde Höchenschwand als heilklimatischer Kurort von Reichsfremdenverkehrsverband Berlin anerkannt.
Ab 1970 gab es in Baden-Württemberg die große Kreis- und Gemeindereform. Diese stand unter der Überschrift „Verwaltungskraft stärken“. Das hatte auf dem Höchenschwanderberg insofern sehr schnell Früchte getragen, als am 1. Juli 1971 die Gesamtgemeinde Tiefenhäusern mit den Ortsteilen Heppenschwand, Frohnschwand, Oberweschnegg, Unterweschnegg und Tiefenhäusern eingemeindet wurden. Mit der Gesamtgemeinde Amrigschwand mit den Ortsteilen Amrigschwand, Attlisberg, Ellmenegg, Segalen und Strittberg war das schwieriger. Deren Bürgermeister Wilhelm Eckert, bis zur Eingemeindung der einzige Bürgermeister nach dem Krieg, war ein sehr geschichtsbewusster, gebildeter Mann mit Ecken und Kanten. Er wollte auf keinen Fall die Eingemeindung nach Höchenschwand. Diese Haltung war teilweise auch geschichtlich begründet, denn Höchenschwand und der „Berg“ waren über Jahrhunderte getrennt. Höchenschwand gehörte zum „Zwing und Bann“ des Klosters St. Blasien und der „Berg“ zur Grafschaft Hauenstein. Letztlich gab Eckert seinen Widerstand auf und der Eingemeindungsvertrag wurde am 1. Oktober 1974 geschlossen.
Der Tourismus und die Kurkrisen
Höchenschwand (pic) Der Erfolg des Kurortes Höchenschwand war immer eng mit den Belegungszahlen in den Sanatorien und Kliniken verknüpft. Parallel dazu haben Gemeinde und Gemeinderat versucht, die kurörtliche Infrastruktur an die steigenden Übernachtungszahlen anzupassen. Beispiele für größere Investitionen waren der Bau des beheizten Waldfreibades (1974), damals für eine Gemeinde auf 1000 Meter Höhe eine ganz große Sache. Es folgte 1981 für rund acht Millionen der Bau des Haus des Gastes, bis zum heutigen Tag die größte Einzelinvestition für die Gemeinde Höchenschwand.
Von 1987 bis 1998 folgte die erste Ortskernsanierung mit der damals wichtigen Umgestaltung des Kurhausplatzes, dem Abriss der Milchbar und der Erweiterung des Kurparks und der Grünzonen über die Straße „Im Grün“. Dann kam 1989 die Wiedervereinigung, für Höchenschwand ein ganz entscheidendes Jahr. Plötzlich hatten 17 Millionen Bürger aus dem Osten die gleichen Rechte nach dem Sozialgesetzbuch. Es herrschte ein unglaublicher Andrang und die Versicherungen suchten dringend zusätzliche Betten. Dies führte in Höchenschwand zu großen, privaten Investitionen. Innerhalb von zwei Jahren (1992 bis 1993) hatten die Kliniken Erweiterungsbauten hochgezogen. Im Jahr 1994 verzeichnete der Ort mit 462.000 Übernachtungen ein Rekordergebnis.
Durch die „Seehoferische Gesundheitsreform“ kam ein dramatischer Einbruch, in deren Folge die Übernachtungszahlen auf 215.000 einbrachen. Ein unglaublicher Absturz mit katastrophalen Auswirkungen in allen Bereichen. Allein
300.000 bis 400.000 DM Minus bei der Kurtaxe. Die Umsatzzahlen im Wasser- und Abwasserbereich halbierten sich, sodass die Gebühren stark erhöht werden mussten.
Auch für den Ort hatte dieser Einbruch dramatische Auswirkungen. Als Folge der Kurkrise mussten einige Kliniken, Gasthäuser und viele Geschäfte schließen. Die Gemeinde versuchte, den Kurort mehr in Richtung Urlauber umzustrukturieren. Es wurde das Natursportzentrum mit der Teamwelt, der Tennishalle, der Saunalandschaft und der Rothaus Zäpfleturm gebaut. Trotz der Anstrengungen konnten die Übernachtungszahlen nur auf einem niedrigen Niveau stabilisiert werden.