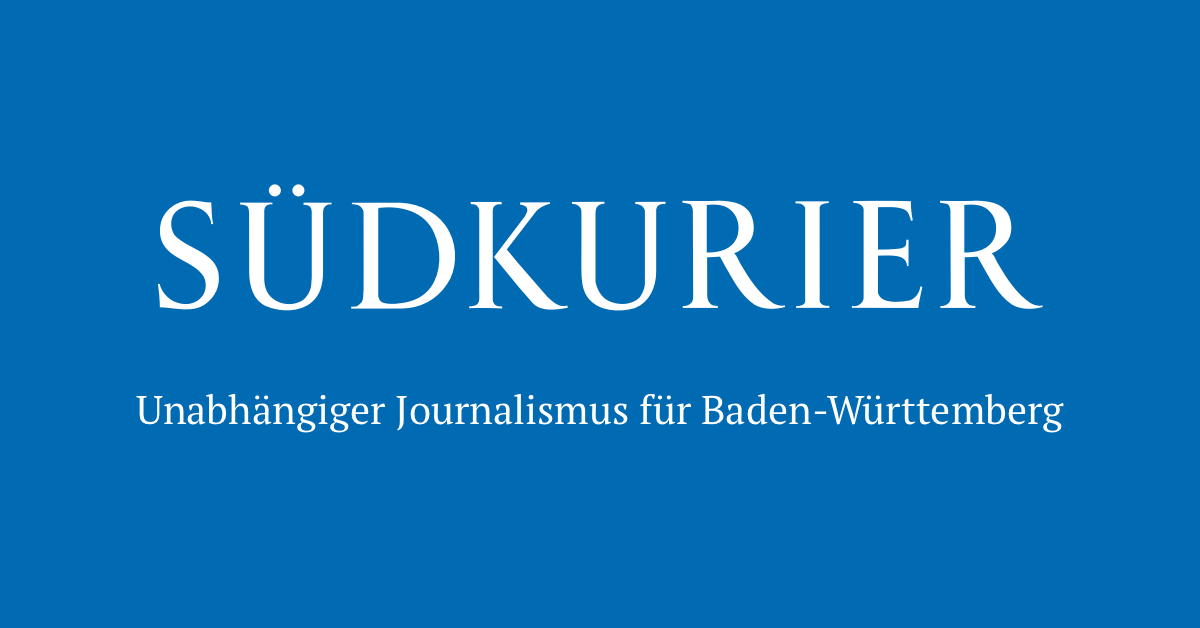Die Mängelliste, die Experten für die Atomkraftwerke Fessenheim und Beznau erstellen, ist endlos. Die beiden ältesten Atomkraftwerke Frankreichs und der Schweiz erfüllen zudem nicht die Sicherheitsnormen, die das Netzwerk der europäischen Atomaufsichtsbehörden WENRA erstellt hat. Bei seiner Jahresversammlung am Mittwoch verabschiedete der Trinationale Atomschutzverband TRAS im Basler Rathaus deshalb einen erneuten Aufruf zur sofortigen Abschaltung der beiden Kraftwerke.
Aus technischer, materialwissenschaftlicher aber auch ökonomischer Sicht sind die beiden Kraftwerke längst nicht mehr haltbar. Darüber waren sich drei geladene Referenten einig. „Fessenheim wäre heute nicht mehr genehmigungsfähig“, sagt etwa Manfred Mertins, der als Sachverständiger bei der deutschen Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) an Regelwerken mitgeschrieben hat. So gelte heute international die Regel der dreifach hundertprozentigen Sicherheit. Falle also ein Sicherungssystem im Notfall aus, etwa weil es gerade gewartet werde, müsse ein zweites einspringen. Falle dieses ebenso aus, müsse ein drittes zur Verfügung stehen. Fessenheim verfüge aber beispielsweise nur über zwei Systeme zur Notkühlung, die sich auch noch gegenseitig beeinflussten. „Das ist heute verboten“, so Mertins. Auch wenn heutige Sicherheitsmaßstäbe noch lange nicht galten, als das Atomkraftwerk Fessenheim 1977 in Betrieb ging, müssten Normen eingehalten werden. Zu dem erst jüngst bekannt gewordenen Störfall vom April 2014, bei dem es zu einer Teilüberflutung des Reaktorschutzsystems gekommen war, bemerkte Mertins einigermaßen fassungslos: „Das ist eigentlich unvorstellbar für ein Atomkraftwerk.“
Zwar gelten für neue französische Atomkraftwerke, wie etwa den noch immer im Bau befindlichen EPR-Reaktor in Flamanville, heute strengere Sicherheitsvorschriften – und man sei im Fall von Fessenheim immerhin bemüht, allzu offensichtliche Sicherheitslücken zu schließen. Nicht alles lasse sich aber überhaupt nachrüsten und etwa die nachträgliche Verstärkung der Fundamentplatte sei „beachtlich knapp“ ausgefallen. Fessenheim bleibe zudem ausgesprochen erdbebenunsicher.
Erhebliche Bedenken bestehen auch beim Schweizer Akw Beznau, das 1969 in Betrieb ging – dem heute ältesten der Welt. Die Materialwissenschaftlerin Ilse Tweer, die unter anderem für das Institut für Risikoforschung der Universität Wien arbeitet, hat sich mit Reaktordruckbehältern beschäftigt. „Sie sind das Kernstück einer Anlage und dürfen einfach nicht versagen“, so Tweer. Ihr Material wird durch Neutronenbestrahlung und thermische Beeinflussung mit dem Alter schlechter.
Wurden bei den belgischen Reaktoren Doel und Tihange aber bei einer Überprüfung tausende Fehlstellen gefunden und in Beznau immer noch 925, wurde Fessenheim bisher gar nicht untersucht. Nach Betreiberangaben handele es sich bei den gefundenen Fehlstellen aber nicht um Alterserscheinungen, sondern um von Anfang an bestehende Fehler. Ohnehin rechne man sich, ob in Belgien oder der Schweiz, die Realität gerne schön und wende immer dann, wenn Grenzwerte überschritten würden, einfach neue Messmethoden an. Dieses Phänomen bemerkt auch der Basler Ökonom Kaspar Müller, einst Bankfachmann und später Präsident der Genfer Ethos-Stiftung. Er sieht die Schweizer Atomindustrie in einer erheblichen finanziellen Schieflage, was nicht zuletzt damit zu tun habe, dass Rücklagen für die Entsorgung erst viel zu spät gebildet wurden.
Müller geht davon aus, dass die Akw-Betreiber die Laufzeiten ihrer Anlagen deshalb immer weiter verlängern wollen, um die endgültige Rechnungslegung zu verschieben. Schon 1997 habe aber eine Studie der Bank Crédit Suisse belegt, dass die Kosten uneinholbar seien. Inzwischen seien dank Wind- und Sonnenenergie auch noch die Preise verfallen. „Kernenergie war nie wirtschaftlich und wird es nie sein“, so Müllers Fazit. Weshalb die französische Elektrizitätsgesellschaft EdF jetzt auch noch Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe vom Staat fordern könne, sei für ihn schon gar nicht nachvollziehbar.