Nach drei Stunden griff der Rickenbacher Gemeinderat Timo Häßle (FW) am Samstag in der Gemeindehalle Willaringen auf der Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative Windkraft und Freiflächen-PV-Anlagen zum Mikrofon. Mit bewundernswertem Mut wandte er sich bezüglich des eigentlichen Themas, des von der Gemeinde Rickenbach geplanten Bürgerwindrads, an die Referenten des Abends: „Ich frage mich, weshalb der ganze Abend an der Gemeinde Rickenbach vorbeigeht“ – ohne eine Antwort zu erhalten. Ein bewundernswerter Mut deshalb, da Moderator Martin Ruthenberg Kritikern der Referenten zuvor konsequent das Mikrofon verweigert hatte und etwa BUND-Vertreter Michael Tritschler für sein Bekenntnis zur Windkraft höhnisches Gelächter erntete.


Informationsveranstaltung baut keine Brücken
Mit seinen Worten fasste Häßle in Worte, was in den Vorträgen der Referenten Theo Feger aus dem Wolftal bei Wolfach und Rechtsanwalt Thomas Mock aus Königswinter weitgehend fehlte – der Bezug zum Bürgerwindrad in Rickenbach. Doch nicht nur das, Häßle brachte mit wenigen Worten zum Ausdruck, was an diesem Abend wahrlich nicht gelungen war, nämlich „Brücken über aufgerissene Gräben zu bauen“.

Diesen Anspruch hatte Elvira Stehle, Vertrauensperson der Bürgerinitiative, für die Informationsveranstaltung erhoben – und ihre Ausführungen mit einem Satz beendet, der Bände sprach. Gehe es ihr dabei doch um eine „Wahrheit, die sich nicht zensieren lasse“. In welche Richtung sie damit zielte, machte Ruthenberg als Moderator und Mitglied der Bürgerinitiative in seinen anschließenden Ausführungen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Journalisten im Allgemeinen unmissverständlich klar – würden sie doch eine offene Diskussion und eine Abbildung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse verhindern.
„Die neue Wahrheit setzt sich erst durch, wenn die Vertreter der alten Wahrheit gestorben sind“, gab er dem Publikum in der mit etwa 100 Besuchern besetzten Gemeindehalle Willaringen hierzu mit auf den Weg. Wie diese Durchsetzung von statten gehen soll, machte er bei kritischen Einwendungen dann schnell deutlich: „Das brauchen wir hier jetzt nicht weiter zu diskutieren.“

Es geht um verschwiegene Wahrheiten und Profit
Ein Ansatz, dem sich der in der Vermessungsbranche tätige Feger in seinem Referat nahtlos anschloss. Gehe es ihm nach Ruthenbergs Worten doch darum, aufzuzeigen, „wie Wahrheiten verschwiegen werden“. Feger ließ seinem Aufruf, „aufzustehen, damit unsere Heimat nicht den Bach runtergeht“, den Hinweis folgen, dass zahlreiche Berichte und Studien zur Windkraft „oft verlogen sind. Es geht hierbei um viel Geld und da ist es dann oft schwierig, mit der Wahrheit umzugehen.“
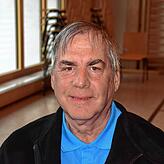
In seinen Ausführungen wählte Feger einen Weg zwischen schweren Anwürfen an Politik, Verwaltung und Windkraftindustrie einerseits sowie schwerer Kritik an den negativen Folgewirkungen der Windkraft für Mensch und Natur andererseits. So bedeute „eine planlose Energiepolitik“ den Verlust der Heimat und mit der Umsetzung der Planungen der Regionalverbände sei „der Weg zur Selbstzerstörung“ beschritten.
Thesen, die Feger immer wieder mit Vorwürfen über eine von ihm postulierte „Manipulation der Öffentlichkeit“ verband: „Die planwirtschaftliche Energie führte zu Gesetzen, um kritische Bürger mundtot zu machen. Diese Gesetze wurden in Europa, Deutschland und Baden-Württemberg verabschiedet, um den Naturschutz und die Meinungsfreiheit auszuschalten.“ Über 50 Gesetze habe die Ampel-Koalition mit diesem Ziel auf den Weg gebracht, „und die neue Regierung Merz setzt diese energiepolitische Geisterfahrt weiter fort. Sie will auch noch das Informationsfreiheitsgesetz abschaffen.“

Das Bürgerwindrad kommt bei den Referenten nicht vor
Ein Bezug zu dem beim Rickenbacher Ortsteil Hottingen geplanten Bürgerwindrad auf dem Hoheneck fehlte in seinen Ausführungen gänzlich. Einzig in seinem Verweis auf eine scheinbare Windarmut in Bayern und Baden-Württemberg mochte für das Publikum ein regionaler Bezug gelegen haben. Kritikpunkte wie den Geräuschpegel der Windkrafträder, Baumaßnahmen in der Natur, Gefährdungen des Grundwassers oder einen giftigen Abrieb von den Rotorblättern untermauerte er nicht durch Zahlen oder Studien, sondern mit Vorwürfen und zweideutigen Aussagen. So würden „die Gefahren unter den Teppich gekehrt“, Geschädigte „mit Geld geschmiert, damit sie still halten“ und bei den Baufirmen seien auch „viele Osteuropäer unterwegs.“

Eine Ansammlung von Vorwürfen, denen Rechtsanwalt Thomas Mock in Bezug auf das Rickenbacher Windrad ebenfalls keine Erläuterungen folgen ließ. Zwar sei er kein Windkraftgegner, sondern ein Gegner der Standorte dieser Anlagen, doch konzentrierte auch er sich auf das scheinbare Zusammenspiel von Politik und Windkraftindustrie als den Profiteuren der Energiewende: „Geld und politischer Druck führen zu Genehmigungen, die sich als Widerspruch zeigen“, erklärte Mock.
Der Rechtsanwalt entwarf das Szenario eines von der Bundesnetzagentur für Baden-Württemberg besonders profitabel gestalteten Geschäfts mit der Windenergie: „Ich kann in Baden-Württemberg pro Jahr 2 Millionen Euro für eine Windkraftanlage erlösen und das garantiert auf 20 Jahre. Wenn ich Kosten in der Höhe von sieben Millionen Euro habe und konservativ gerechnet 40 Millionen dafür erlöse, ist das ein gutes Geschäft. Deshalb ziehen hier die Projektierer über Land und sichern sich die Grundstücke. Die Eigentümer der Grundstücke sind der goldene Schlüssel für die Projektierer.“

Windkraftindustrie und Grundstückseigner als große Profiteure
Die von ihm hier genannten Pachtzahlen ließen selbst das Publikum staunen: „Sie bieten eine sehr hohe Pacht, es gibt Gebote von 500.000 Euro pro Grundstück im Jahr. Da lacht der Grundeigentümer wie ein Lottomillionär.“ Damit verbundene Erläuterungen zu steigenden Lebensmittelpreisen, der CO₂-Steuer, dem System des Emissionshandels oder dem Erneuerbare-Energie-Gesetz von 2023 zeichneten das Bild von „großen Energiekonzernen, die im Laufe der Jahre immer mehr zu Subventionskonzernen werden.“
Was dies alles mit dem Bürgerwindrad in der Gemeinde Rickenbach auf dem Hotzenwald zu tun hat, wurde an diesem Abend allerdings nicht deutlich – bis, ja genau bis Gemeinderat Timo Häßle diese Frage nach mehreren Stunden in der Willaringer Festhalle in den Raum stellte und auf seine Frage keine Antwort erhielt.






