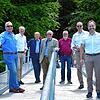Die Liedzeile „Alle Vöglein sind schon da“ umschreibt annähernd das, was der Stockacher Gymnasiallehrer Jörg Dieterich, der ehrenamtlich für die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee (OAB) macht: Er zählt in diesen Wochen Vögel im Rahmen der zweiten Saison der bisher fünften Bodensee-weiten Brutvogelkartierung in einem Gebiet, das von Bodman bis Sipplingen reicht. Diese Kartierung findet statt, um einen Überblick über den Gesamtbestand der Vogelwelt am Bodensee zu erhalten und darüber, welche Arten hier eigentlich so vorkommen, heimisch sind oder vielleicht auch nur durchreisen.
Jörg Dieterich hatte im Jahr 2000 zum ersten Mal Kontakt mit den Bodensee Ornis, wie sie auch genannt werden. Seitdem war der Lehrer für Biologie und Chemie Jahr für Jahr an den Zählungen beteiligt. Vorher habe er nicht so viel mit diesen Tieren zu tun gehabt, sagt Dieterich, aber dann habe ihn die Faszination gepackt.
Alles wird in Planquadrate aufgeteilt
Dieterich erklärt, wie so eine Brutvogelkartierung abläuft: „Die gesamte Bodenseeregion, inklusive Uferregion und auch Hinterland wie der Hegau oder das Schussental, wird in insgesamt 303 Rasterquadrate zu je zwei mal zwei Kilometer aufgeteilt. Auf diesen jeweiligen Planquadraten versuchen dann 89 ehrenamtliche Mitarbeiter Daten zu erfassen“. Dies geschieht länderübergreifend, also auch in Österreich und der Schweiz.
Jede Person habe in zwei Gebieten zu zählen, die sie innerhalb von zwei Jahren fünf Mal zu ganz unterschiedlichen Zeiten begeht. Es gibt Vorgaben, welche Strecken innerhalb welcher Landschaftsgebiete (Uferregionen, Wälder, Wiesen) und wie viele Kilometer insgesamt abgelaufen werden müssen. Die erste Begehung sollte nicht vor dem 1. März, die letzte nicht nach Mitte Juni stattfinden.

Auch das Wetter spiele laut Dieterich eine Rolle: Nieselregen störe nicht, bei Starkregen oder Sturm aber sängen die Vögel nicht. Auch die Tageszeit sei ein wichtiger Faktor, denn manche Vögel sängen lieber abends, andere lieber morgens und in manchen Gebieten kämen bestimmte Vögel besonders häufig vor. In einem Jahr habe er einen Trauerschlepper in einem Waldgebiet entdeckt, im Folgejahr jedoch nicht mehr. Diesen Vogel, der normalerweise auch eher in Streuobstwiesen heimisch ist, habe er dann nicht mitgezählt. „Er war vermutlich nur auf der Durchreise.“
Es sei also bei der Brutvogelkartierung auch Ehrlichkeit gefragt. Das Zählen anhand der halbquantitativen Gitterfeldrasterkartierung, wie die Methode heißt, funktioniere wie folgt: Die Strecken werden abgelaufen und dann versucht man alle Arten anhand dessen, was man höre, zu erfassen. Dann folge eine Hochrechnung.
Die männlichen Vögel singen
Man höre übrigens vorrangig die werbenden Männchen, die durch den Gesang ihr Revier markieren, sagt Dieterich. Hierbei sei es durchaus eine Herausforderung, die einzelnen Vogelstimmen zu erkennen, denn manche seien ziemlich deutlich hörbar, andere wieder recht still. Darum sei es noch besser, wenn man die Vögel auch sichte, denn erst dann könne man sich richtig sicher sein. Laute gäben alle Vögel von sich, aber man müsse unterscheiden, was die Vögel da tönen, sagt er. Man könne diese Töne aber lernen.
Je fitter man im Erkennen sei, desto besser klappe es auch mit dem Zählen. Natürlich habe man die Ambition, alle zu erkennen, jedoch gäbe es auch seltene Arten. Zum Beispiel habe Dieterich schon mal einen Neuntöter auf dem Gebiet des Haldenhofs oberhalb von Ludwigshafen nachgewiesen. Dieser Vogel heißt so, weil er Heuschrecken oder Mäuse auf Dornen aufspießt, bevor er sie irgendwann verspeist.
Mit den durch die Brutvogelkartierung zusammengetragenen Daten lassen sich viele Fragen beantworten und Trends erkennen: Welche Arten nehmen ab, welche zu, welche sind stabil? Woran liegt das? Man könne so etliche Rückschlüsse zu ziehen bezüglich des Artensterbens, der Klimakrise und der Biodiversität im Allgemeinen.

„Es ist alles miteinander verbunden“, sagt Jörg Dieterich und gibt auch gleich ein Beispiel: „Die Vögel der offenen Feldflur werden seltener.“ Dies hänge mit dem Insektensterben zusammen, aber auch mit der Versiegelung der Flächen durch Straßenbau.
Die Organisation
Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee (OAB) machte im gesamten Bodenseegebiet 1980 bis 1981, 1990 bis 1992, 2000 bis 2002 und 2010 bis 2012 vier halbquantitative Gitterfeldkartierungen. Diese Form der Erfassung bietet eine der einfachsten Möglichkeiten, Brutvogelbestände auf größerer Fläche zuverlässig und relativ genau zu ermitteln. Im Winter gibt es die Wintervogelzählung auf dem See, wo im Winter andere Arten als im Sommer leben, denn der Bodensee ist ein wichtiges Überwinterungsgebiet: Im vergangenen Winter waren das 100.000 bis 200.000 Wasservögel. Aktuell, 2020 bis 2022, läuft die fünfte Brutvogelkartierung. Corona-bedingte Maßnahmen führten in diesem und im vergangenen Jahr zu einigen Erschwernissen, konnten jedoch laut OAB erfolgreich abgeschlossen werden. Für die aktuellen Erhebungen sucht der OAB noch Mitarbeiter.
Infos und Kontakt unter
www.bodensee-ornis.de