Vor 20 Jahren begann die Renaturierung des Rheinufers zwischen Stein und Schaffhausen – darunter auch der Rheinuferpark in Gailingen. Jetzt ziehen die Projektleiter Bilanz: 25 Prozent sind geschafft. Doch nach der Renaturierung öffentlicher Flächen geht es jetzt darum, Privatleute zu überzeugen, um weiter machen zu können.
Als Rheinmacher sind Peter Hunziker, Walter Vogelsanger und Urs Capaul bekannt. Seit 20 Jahren entwickeln sie Ideen, wie die Hochrhein-Uferzone zwischen Stein und Schaffhausen naturnäher gestaltet werden kann. Mit über 100 Interessierten haben sie jetzt auf einer rund drei Kilometer langen Tour Bilanz gezogen.
Jungfische wurden einfach weggeschwemmt
„Früher wurde jeder Quadratmeter Land und Wald mit Hartverbauungen geschützt“, berichtet Projektleiter Peter Hunziker. An den verbauten Ufern habe es keine strömungsberuhigten Zonen gegeben und die Jungfische wurden rheinabwärts weggeschwemmt. Im Konzessionsgebiet des Kraftwerks Schaffhausen von Gailingen bis Flurlingen waren nur noch etwa drei Prozent der Ufer in einem natürlichen Zustand. Doch das sollte sich ändern.
Der Bestand der Jungfische, die entlang der renaturierten Abschnitte mit Kiesbänken, Buchten, Buhnen, Baumstämmen und Wurzelstöcken strömungsberuhigte Zonen vorfinden, ist inzwischen bis um das 50-fache höher als entlang der noch verbauten Abschnitte. In Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Sempach wurden auch für den Eisvogel an sechs Stellen Brutwände errichtet, in denen er sich bereits niedergelassen und gebrütet hat. Bei der Begehung zeigte Hunziker auch hinüber an das Ufer der deutschen Exklave Büsingen, das vor den Renaturierungsarbeiten mit Kalksteinen und Mauern verbaut war.
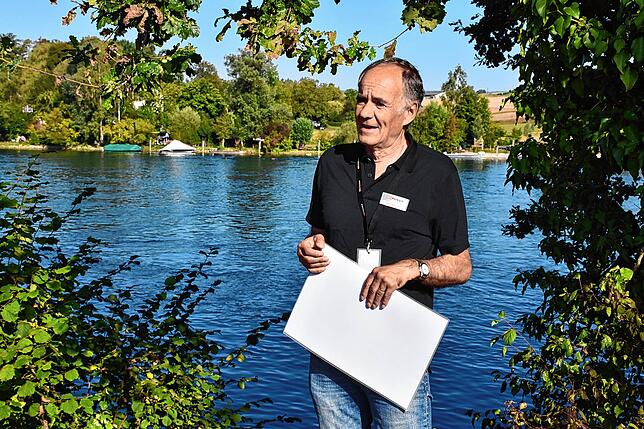
Das erste Projekt war eine gemeindeeigene Parzelle oberhalb der Kläranlage. Hunziker bemerkte, dass die restlichen Parzellen bis zum Ortseingang privaten Anliegern gehören und es immer schwieriger ist, Privatparzellen zu renaturieren, als wenn Kreis, Kanton oder Kommune involviert sind. „Auf der Schweizer Seite hat man auf hunderten Meter mit den Kantonen Schaffhausen oder Thurgau oftmals nur einen Ansprechpartner“, so Hunziker.
Inzwischen kommen Leute auf sie zu
Er erinnert sich an die Anfangszeiten, wo er viel Energie aufwenden musste, um für die Renaturierungsmaßnahmen zu werben. Da sei oftmals viel Fingerspitzengefühl und Sensibilität nötig gewesen. „In den letzten Jahren hat sich das stark gewandelt, die Leute kommen mittlerweile auf uns zu“, sagt Hunziker erfreut. Aber auch geltendes Recht helfe, da beispielsweise eine einsturzgefährdete Verbauung nicht neu erstellt oder saniert werden darf, wenn keine Liegenschaft oder Straße dadurch gefährdet wird.
Hunziker erinnert daran, dass er es zunächst für einen Scherz hielt, als der ehemalige Büsinger Bürgermeister Markus Möll auf ihn zugekommen sei, um zu sagen, dass ein Anwohner eine vier Meter hohe Ufermauer unterhalb der Anlegestelle Büsingen abbrechen wolle, um ein natürliches Ufer zu erreichen. Mittlerweile wurde in vier weiteren Etappen vom westlichen Ortseingang bis zur Kläranlage über ein Kilometer Hartverbauungen zurück gebaut.
Schönheitsfehler im Gailinger Rheinuferpark
Im kommenden Winter wird ein 40 Meter langes Uferstück renaturiert, das eine lange Vorplanung benötigte, weil es sich um eine Liegenschaft mit Stockwerkeigentum handelt, bei dem alle Eigentümer zustimmen mussten.
Nicht ohne Stolz hat Hunziker darauf hingewiesen, dass die bisher realisierten Projekte sämtlichen Hochwasser-Fällen standgehalten haben. „Lediglich beim Uferpark Gailingen hat es etwas gerappelt und es sind kleinere Schönheitsfehler, die noch behoben werden“, sagt der Rheinmacher. Inzwischen wurden rund 10 Millionen Franken investiert.

Der für das Konzessionsgebiet zuständige Fischereiaufseher Stefan Eglauf betonte an seinem Informationsposten, dass dieser Rheinabschnitt früher die größte Äschen-Population der Schweiz hatte, die allerdings massiv zusammengebrochen ist. Nachdem 1997 viele Äschen von den Kormoranen gefressen wurden, fielen im Hitzesommer 2003 mit rund 52.000 Äschen etwa 95 Prozent des Bestandes den hohen Wassertemperaturen zum Opfer.
Die Äsche hat ihren Wohlfühlbereich bei Wassertemperaturen von vier bis 18 Grad. Bei 20 bis 22 Grad stellt der kulinarisch beliebte Fisch die Nahrungsaufnahme ein und bei 24 Grad gleitet er in den tödlichen Bereich.

Wachsames Auge auf Äschen-Bestand
Nach einem dreijährigen Fangverbot habe sich der Bestand wieder etwas erholt. Im Jahr 2018 kam dann aber der nächste Hitzesommer, der mit Wassertemperaturen von knapp 27 Grad noch heißer war als 2003 und den Bestand wiederum um 95 Prozent reduziert habe. Seit 2018 ist die Äsche geschützt und wird nicht mehr befischt. „Im Jahr 2022 gab es wieder einen Hitzesommer und im letzten Jahr standen wir knapp davor“, sagte Eglauf.
Er erklärte, dass sich die Äsche auf diesem Abschnitt in den Laichplätzen unter normalen Bedingungen reproduzieren kann. Bis 2018 wurden sie gefangen, in den Fischzuchtanlagen vermehrt und wieder eingesetzt. Seit man weiß, dass die Äsche, wenn sie natürlich schlüpfen und von Anfang an im angestammten Wasser Nahrung aufnehmen kann, widerstandsfähiger ist, wird auf den Fischbesatz verzichtet.

Eglauf erklärte, dass man der Äsche helfen kann, indem man möglichst gute Habitate zur Verfügung stellt, Laichplätze aufwertet, Seitenbäche vernetzt und Kaltwasserzonen errichtet. Als aktuelles Beispiel wurde im vergangenen Winter beim Restaurant Paradies in Schlatt der Mülibach ausgedohlt und ein natürliches Bachgerinne mit einer drei Meter tiefen Kaltwasserwanne erstellt. Darin können sich die Fische bei hohen Temperaturen zurückziehen.
Eglauf weiß aber nicht, ob der Bestand der Äschen mit solchen Projekten wirklich langfristig gehalten werden kann. „Wenn die Äsche hier irgendwann dennoch verschwinden sollte, haben wir zumindest gute Voraussetzungen für andere Fischarten geschaffen, die durch den fortschreitenden Klimawandel künftig Probleme bekommen werden“, sagte Eglauf.
„Die Bezieher des Ökostroms ermöglichen uns, auch in Zukunft solche Projekte zu realisieren“, betont Hunziker abschließend. Der 67-Jährige wird im Herbst in den Ruhestand eintreten. Seine Nachfolgerin ist die Umweltwissenschaftlerin Michèle Vogelsanger, Tochter des Rheinmachers Walter Vogelsanger. „Die Renaturierungsprojekte gehen nicht aus und Michèle wird bis zu ihrer Pensionierung noch damit zu tun haben“, lautet Hunzikers Prognose für die kommenden Jahre.







