Mit der „Tabor“ könnte bald die erste vollelektrische Autofähre auf dem Bodensee fahren. Die Umstellung der Fähren auf emissionsfreie Antriebe soll einen Beitrag dazu leisten, dass die Stadt Konstanz bis 2035 weitgehend klimaneutral wird. Das bestätigt auch Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke: „Dieser Schritt würde die Stadt ihrem Ziel deutlich näherbringen.“ Die Stadtwerke haben die mögliche Umrüstung bereits geprüft und Fördermöglichkeiten beantragt.

Oberbürgermeister Uli Burchardt regte ebenfalls jüngst an, zwei Fähren der Stadtwerke auf einen vollelektrischen Antrieb umzurüsten. Er nutzte das Thema als Beispiel dafür, dass aus seiner Sicht Investitionen in den Klimaschutz dort getätigt werden sollten, wo sie den größten Nutzen bringen. So habe die Umrüstung der Schiffe einen ähnlichen Effekt wie die Wärmesanierung aller städtischen Gebäude zusammen.
Für die „Tabor“ gibt es diesbezüglich bereits konkrete Pläne, wie die Stadtwerke auf SÜDKURIER-Anfrage mitteilten. So soll die derzeit dieselelektrische Fähre im Falle einer Förderung auf einen vollelektrischen Antrieb umgerüstet werden.
Welche Bedenken äußert Stadtrat Roland Ballier?
Doch zu dem Projekt gibt es auch kritische Stimmen. Stadtrat Roland Ballier von den Freien Wählern hält die Rechnung des Oberbürgermeisters für überzogen, mit dem Betrieb einer Elektrofähre zeitnah so viel CO2 einsparen zu können. „Bei der Gebäudesanierung haben wir tatsächlich eine Energieeinsparung, das ist sinnvoll“, so Ballier. Die Fährumrüstung wäre hingegen bei den aktuellen Bedingungen nicht zielführend und würde die Verschuldung der Stadt nur noch weiter beschleunigen.
Unter anderem spricht Ballier die Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Ressourcen an. „Solange der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt, mag die Rechnung zum Teil aufgehen“, so Ballier. Doch eine Fähre müsse auch dann fahren, wenn weder Wind weht noch die Sonne scheint. „Bei den Dunkelflauten brauchen wir auch fossile Energie“, sagt der Stadtrat. Dann müssten die Batterien der Fähren auch mit Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken geladen werden.

Der Stadtrat betont, dass er erneuerbare Energien grundsätzlich unterstützt: „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin ein absoluter Fan davon – aber ich bin auch Realist.“ Seiner Einschätzung nach werde es noch dauern, bis die Fähren vollständig mit grünem Strom betrieben werden können.
Pedro da Silva, Professor für technische Gebäudeausrüstung und erneuerbare Energien an der Hochschule Konstanz, schätzt die Bedeutung von Dunkelflauten geringer ein: „Dunkelflauten, die mehrere Tage andauern, treten in der Regel etwa alle zwei Jahre auf.“ Im Verhältnis zur Gesamtzeit des Jahres spielten diese keine große Rolle.
So hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien
Auch wenn es derzeit noch keine 100-prozentige Versorgung mit erneuerbarem Strom in den deutschen Netzen gibt, sieht da Silva die Entwicklung positiv: „Wir hatten die letzten beiden Jahre schon über 60 Prozent erneuerbare Energie.“ Er macht deutlich: „Wir wollen auf 100 Prozent kommen.“
Seiner Einschätzung nach könnte dieses Ziel beim derzeitigen Ausbautempo bis 2040 realistisch erreicht werden. Für eine vollelektrische Fähre planen die Stadtwerke laut Geschäftsführer Norbert Reuter den Einsatz von zertifiziertem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Für die Fähre „Tabor“, die noch mindestens 20 Jahre im Einsatz sein soll, könne also von einem zunehmend dekarbonisierten Betrieb gesprochen werden.
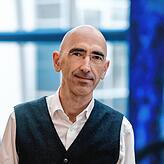
Ist ein Dieselmotor effizienter – oder nicht?
Neben der Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom hat Roland Ballier einen weiteren Kritikpunkt: Eine vollelektrische Fähre sei weniger effizient und benötige mehr Energie, um die gleiche Leistung wie eine Dieselfähre zu erbringen. Das liege daran, dass die Energie für den Elektroantrieb mehrfach umgewandelt werden müsse, wodurch es zu Verlusten komme. Aus diesem Grund und wegen seiner Annahme, die Elektrofähre könne derzeit bestenfalls mit 50 Prozent grünem Strom fahren, sei der Unterschied im CO2-Ausstoß zwischen Diesel- und Elektromotor letztlich nicht so groß wie angenommen.
Die Stadtwerke widersprechen dieser Einschätzung: Der derzeitige Antrieb der „Tabor“ habe einen maximalen Wirkungsgrad von 50 Prozent, während ein vollelektrischer Antrieb auf etwa 80 Prozent komme. Der Elektromotor wäre also deutlich effizienter. „Die Energie wird direkt in Akkus gespeichert und ohne Umwandlungsverluste an die Elektromotoren weitergegeben“, erklärt Reuter.
Auch das Gewicht der Fähre ändere sich durch den Umbau nicht: „Die neuen E-Motoren und Akkus sind nicht schwerer als die alten Dieselgeneratoren.“ Auch Pedro da Silva betont, dass ein Elektromotor trotz des notwendigen Umwegs über die Batterie und den daraus resultierenden Umwandlungsverlusten nicht mehr Energie verbrauche als ein Dieselmotor und zudem wesentlich weniger CO2 produziere.
Grundsätzlich hält er es für wenig sinnvoll, fossile und erneuerbare Energien unter dem Aspekt der Effizienz miteinander zu vergleichen: „Diesel wird irgendwann aufgebraucht sein, das ist nicht nachhaltig.“ Im Gegensatz dazu stehe etwa Solarenergie: „Die Sonne wird uns dauerhaft zur Verfügung stehen.“
Ist das Projekt überhaupt derzeit finanzierbar?
Stattdessen hält der Professor einen anderen Vergleich für sinnvoller: „Berechtigt wäre ein finanzieller Vergleich.“ Man könne sich die Frage stellen, wie viel Geld in welche Maßnahmen investiert und wie viel CO2 dann im Vergleich eingespart wird. „Für die Gebäudesanierung ist es sehr leicht, an Fremdkapital zu kommen, das sollte unabhängig von allen anderen angegangen werden“, rät da Silva.
Stadtrat Roland Ballier sieht die Umrüstung der Fährschiffe vor allem aus finanzieller Sicht kritisch: „Ich bin fürs Sparen.“ Zwar befürworte er die Nutzung von Fördergeldern, doch oft werde vergessen, dass die Gesamtkosten dennoch hoch bleiben. Das gelte auch für die Fähre und die Ladeinfrastruktur: „Selbst wenn beispielsweise fünf Millionen bezuschusst werden sollten, bleiben immer noch hohe Gesamtinvestitionen.“
Beim Thema der Finanzierbarkeit des Projekts verweisen die Stadtwerke unter anderem auf den wirtschaftlichen Erfolg der „Tabor“: 2023 erwirtschaftete sie laut Reuter rund 1,93 Millionen Euro Gewinn. Der Umbau des Schiffs würde etwa vier Millionen Euro kosten. „Ein Zuwendungsbescheid von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Höhe von zwei Millionen Euro für einen solchen Umbau liegt vor“, so Reuter.
Zusätzlich würden für die Ladeinfrastruktur im Fährhafen Staad rund 7,3 Millionen benötigt, „wovon der Fährbetrieb sechs Millionen Euro tragen müsste.“ Die gleichen Kosten würden nochmals für die Ladeinfrastruktur in Meersburg anfallen, wie Pressesprecherin Teresa Gärtner jüngst erklärte. „Wir wünschen uns natürlich weitere Förderoptionen in dieser Sache“, macht Reuter deutlich.
Ein Weiterbetrieb mit Diesel kommt für die Stadtwerke nicht infrage: „Er widerspricht den Klimazielen von Bund, Land und Stadt.“ Deshalb sei eine schrittweise Umstellung notwendig. Auch die Stadtverwaltung betont, dass sowohl die Umstellung auf elektrische Antriebe als auch die energetische Sanierung der städtischen Gebäude wichtige Maßnahmen seien. „Es geht der Stadt Konstanz nicht um ein Entweder-oder“, so Pressesprecherin Elena Oliveira.
Pedro da Silva hält die geplante Umrüstung ebenfalls langfristig für sinnvoll: „Insbesondere für eine Stadt wie Konstanz, die den Klimanotstand ausgerufen hat.“ Zudem hebt der Professor einen weiteren Aspekt der Energiewende hervor: die Energieunabhängigkeit. „Wir können erneuerbare Energien selbst produzieren, aber Erdgas nicht.“











