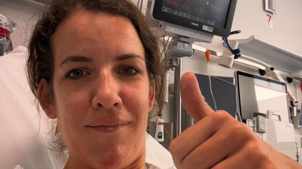Jede Farbe, jeder Geruch, jedes Geräusch ist ein kleiner Zuruf. Wenn Gianna Haas (Name geändert) durch die Straßen läuft, stürmen Geräusche und Gerüche wie Reizgewitter auf sie ein. Die Radolfzellerin ist Autistin und sie sagt: „Die Welt nehme ich viel intensiver wahr und die Reize oft gleichzeitig.“ Filtern oder ausblenden kann Haas sie nicht. Ein Auto dröhnt wie ein Presslufthammer in ihren Ohren, die Sonne blendet grell wie Scheinwerfer, die Scheinwerfer der Autos, die Weihnachtsbeleuchtung im Winter kann Haas kaum aushalten, der Geruch von Parfüm schnürt ihr die Kehle zu.
„Das ist einfach zu viel.“ Dieser Dschungel an Eindrücken. Gianna Haas heißt eigentlich anders. Aus Angst vor Anfeindungen, aus Sorge um ihren Job – „Autismus wird noch immer stigmatisiert“ – will sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Der Name, unter dem sie ihre Geschichte erzählen will, fällt ihr ein, als sie von ihrer Leidenschaft, dem Rock, erzählt. Und von Gianna Nannini, der italienischen Rock‘n‘Soul-Sängerin. „Eine Rebellin mit großem Herz und ganz viel Mut.“ So wie Haas auch. Der SÜDKURIER trifft sie in der Ideenwerkstatt in Radolfzell zum Gespräch.
Schon oft musste sich die Radolfzellerin Ende dreißig durchs Leben kämpfen, erzählt sie. Weil sie anders ist. Unnahbarer in der einen, direkter in der anderen Situation. In der Schule kommt es zu Problemen mit ihren Lehrern und Mitschülern. Im Sportunterricht wird sie gehänselt, weil sie ihren Körper nicht so koordinieren kann wie die anderen. Das schnelle Greifen, Springen und das Passen beim Basketball will ihr nicht gelingen. Beim Völkerball wird sie als Letzte ausgewählt, in den Pausen von ihren Mitschülern gemobbt, weil sie sich für ganz andere Dinge interessiert: Weil sie sich in Bücher vergräbt, anstatt draußen zu spielen. Weil sie jeden Buchstaben, den sie erhascht, auch liest: Die Etiketten auf Marmeladengläsern, die Verpackung von Cornflakes, die Zeitungen, die bei ihren Eltern morgens auf dem Tisch liegen.
Nähe kann sie nicht zulassen
„Als Kind hat Gianna täglich zwei Tageszeitungen, eine überregionale und den SÜDKURIER, verschlungen“, erzählt ihre Mutter. Und Gianna Haas hat ein „Elefantengedächtnis“, wie sie sagt. Was sie liest, vergisst sie nicht mehr. Das merken auch ihre Mitschüler, denen Giannas Verhalten zunehmend suspekt vorkommt. Sie ist schließlich eine, die Nähe nicht zulassen kann. Eine Umarmung, einen Handschlag gibt es bei ihr nicht. Von all den Reizen ermüdet, erscheint sie oft gereizt, rebellisch und wütend.
Macht sie einen Stadtbummel, bedarf es einer ganzen Reihe von Vorkehrungen. Wo soll es hingehen? Wo findet sie Ruhe? Auf einem Stadtplan werden die nächsten Kirchen – ihre Fluchtpunkte – markiert. Das ist wichtig. Denn: „Die Welt da draußen erlaubt mir keine Erholung“, sagt Gianna Haas. Zu viele Eindrücke auf einmal. In Kirchen dagegen ist es ruhig und dunkel.
Und dann ist da noch die Sache mit der Wahrhaftigkeit. „Ironie und Sarkasmus verstehe ich nicht“, sagt sie. Und: „Viel zu oft nehme ich alles wörtlich, wir Autisten haben da unsere ganz eigene Logik.“ Ihr Lieblingsbeispiel: Haas war bei Verwandten eingeladen, es gab Kaffee und Kuchen und eine Menge Kekse. Als ihre Tante zu ihr sagte, „iss“, stopfte Gianna Haas jeden einzelnen Keks in sich hinein. Den verständnislosen Blick ihrer Tante konnte sie nicht deuten. „Ich dachte wirklich, ich soll das alles essen“, erzählt sie heute. Sie erinnert sich noch zu gut an all die Situationen, in denen sie sich ungeschickt anstellte.
Wenn ihre Mitschüler sich nachmittags zum Spielen treffen, wundert sich Haas, wie sie es schaffen, vom Fremdsein zur Freundschaft zu kommen, wie sie sich scheinbar ohne Grund verabredet haben. Eine unsichtbare Wand trennt Gianna Haas von ihnen. Und es bleibt das Gefühl, unverstanden zu sein. Nicht so richtig dazuzugehören. Auch nach der Schule. Gianna Haas beginnt zu studieren. Will Journalistin werden, weil sie gern schreibt, weil sie raus will in die Welt, die es ihr so schwer macht. Und ist dann völlig überfordert an der Universität. „Die Hörsäle, die Bibliothek, alles war überfüllt und laut“, erinnert sich Haas. Konzentrieren kann sie sich dort nicht, also bricht sie ihr Studium ab, macht eine Ausbildung, wird kaufmännische Angestellte – und erlebt sie wieder: Momente, in denen sie aus dem Rahmen fällt, sich nicht zusammenreißen kann, wie andere es gern hätten.
Wenn Kollegen sie erschrecken, ihr körperlich zu nahe treten, wird sie handgreiflich, schreit, boxt, verpasst Ohrfeigen. „Ganz normal ist das nicht, das wusste ich schon immer“, sagt Haas. „Aber was ist schon normal?“ Wenn sie heute von den Erlebnissen spricht, fährt sie mit den Händen durch die Luft, suchend, greifend. Irgendwann schnappen ihre Finger zusammen, als könnte sie etwas festhalten. „Man kann versuchen, sich anzupassen, aber irgendwann fällt die Maske. Auf dem Papier eine Autistin zu sein, ist das eine, wie die Gesellschaft, die Kollegen, darauf reagieren, das ist etwas anderes“, sagt sie dann.
Die Diagnose: Asperger-Autismus
Dabei weiß sie damals noch gar nicht, was mit ihr los ist. Oder, dass sie gar nichts dafür kann, anders zu sein – dass Autismus eine genetische Ursache hat. Die Diagnose fällt in die Zeit eines großen Umbruchs im Leben von Haas. Weil ihr Arbeitgeber insolvent ist, wird sie arbeitslos, schreibt eine Bewerbung nach der anderen, macht ein Praktikum in einem Beruf, in dem sie mit Kindern arbeitet und merkt, wie viel Spaß ihr das macht. „Die Kinder mochten mich. Und die Struktur, die festen Rituale in ihrem Tagesablauf, haben mir gut getan.“
Also beginnt Gianna Haas eine neue Ausbildung. Fast zeitgleich meldet sie sich am Universitätsklinikum Freiburg für eine Autismus-Diagnose an. Denn ihre Mutter äußert schließlich die Vermutung, dass Gianna Autistin sein könnte. „Ich habe mich dagegen gewehrt, wollte das Label Autistin nicht“, erinnert sich Haas. Und trotzdem ist da etwas in ihr, dass wissen will, warum sie die Welt so anders wahrnimmt, warum ihre Bemühungen im Zwischenmenschlichen oft scheitern. Da ist es 2016.
Welches Klischee besonders nervt
Mittlerweile hat Haas die Diagnose Asperger-Autismus bekommen. Und sie hat gelernt, sie auch anzunehmen. Haas sagt, sie sei noch nie so glücklich gewesen. Auch wegen ihres Jobs: Ihr neuer Arbeitgeber nehme sie so, wie sie ist, erkenne ihre Stärken. „Ich kann Kinder gut beobachten, ihre Entwicklungsschritte mitverfolgen.“ Doch vor allem sei Haas glücklich, weil sie endlich sein könne, wer sie ist.
Trotzdem nerve sie ein Klischee über Autisten besonders: Die Empathielosigkeit, die man ihnen nachsagt. „Ich kann es nicht mehr hören“, sagt sie. „Ich kann doch mit anderen fühlen. Punkt.“ Der Punkt wirkt eher wie ein Ausrufezeichen. Trotzig. Genervt. Und ein bisschen wirkt es, als sei das ihr größter Kampf – immer wieder den Vorurteilen entgegentreten, sich von neuem beweisen zu müssen. „Es ist eher so, dass ich zu viel Empathie habe. Und von dem Gefühl überflutet werde.“
Gianna Haas spricht von dem Hirnforscher Henry Markram. Er war schon ein berühmter Neurologe, als sein Sohn mit Autismus zur Welt kam und Markram der Frage nachging, was Autismus eigentlich ist. Seine „Intense World Theory“ ist bis heute wissenschaftlich kaum untersucht, Gianna Haas fühlt sich darin trotzdem gut beschrieben.
„Markram geht davon aus, dass unsere Hirnzellen deutlich aktiver sind als die von Nicht-Autisten“, sagt sie. Die Hirnareale, die für die Wahrnehmung zuständig sind, seien hyperaktiv.
Auch Daniel Nischk, Psychologischer Psychotherapeut beim Zentrum für Psychiatrie Reichenau, sagt: „Autismus ist das Gegenteil von Gefühllosigkeit.“ Und weiter: „Autisten werden von Einzelheiten, von einer Vielzahl von Emotionen überschwemmt.“ Ein Gedanke, den Gianna Haas mag: „Weil es eigentlich heißt, dass uns nichts fehlt. Autisten haben keinen Fehler. Es ist umgekehrt: Wir haben von etwas zu viel.“
(Dieser Artikel erschien erstmals im Oktober 2020.)