Einen Schlüsselmoment in der Stockacher Stadtgeschichte erlebten Zahlreiche Vertreter aus dem Bereich der Landesgeschichte und interessierte Stockacher Bürger beim Vortrag „Stockach nach 1704 – eine Amtsstadt entsteht neu“ mit Museumsleiter Julian Windmöller. Dieser fand im Rahmen der Tagung „Österreich am Bodensee – Mächtige und Mindermächtige im Alten Reich“ statt.
Die Stadt Stockach, die Arbeitsgemeinschaft für Geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, der Bodensee- und der Hegau-Geschichtsverein hatten die Tagung, die in der vergangenen Woche im Bürgerhaus Adler Post stattfand auf die Beine gestellt. Es waren über 25 Wissenschaftler und mehr als 80 interessierte Laien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Stockach zu Gast. Hinzu kamen pro Tag etwa 20 Online-Zuhörer.
Vor seinem öffentlichen Vortrag „Stockach nach 1704 – eine Amtsstadt entsteht neu“ zeigte Museumsleiter und Stadtarchivar Julian Windmöller im Bürgerhaus den Imagefilm der Stadt. Die Leute schmunzelten, als er selbst auf der Leinwand zu Wort kam. „Warum leben wir nicht in Stockach?“, fragte ein Gast spontan seinen Sitznachbarn.
Eine Stadt brennt nieder
Dann ging es gut 321 Jahre zurück: Am 25. Mai 1704 war Stockach im Zuge des Spanischen Erbfolgekrieges vollständig niedergebrannt worden. Windmöller führte aus, wie es dazu gekommen war. Karl II, König von Spanien, von dessen acht Urgroßeltern sechs Habsburger gewesen waren, gehörte zur spanischen Linie des österreichischen Hauses Habsburg. Er verstarb kinderlos, hatte aber kurz vor seinem Tod Philipp von Anjou aus dem französischen Königshaus Bourbon testamentarisch als Erben eingesetzt. Da dies unter starken körperlichen und geistigen Einschränkungen erfolgt war, erkannten die Habsburger das Testament nicht an – es kam zum Spanischen Erbfolgekrieg. Von 1701 bis 1714 stritten die Habsburger und Bourbonen mit ihren jeweiligen Verbündeten um den spanischen Thron. Als vorderösterreichische Stadt gehörte Stockach zur Partei der Habsburger.
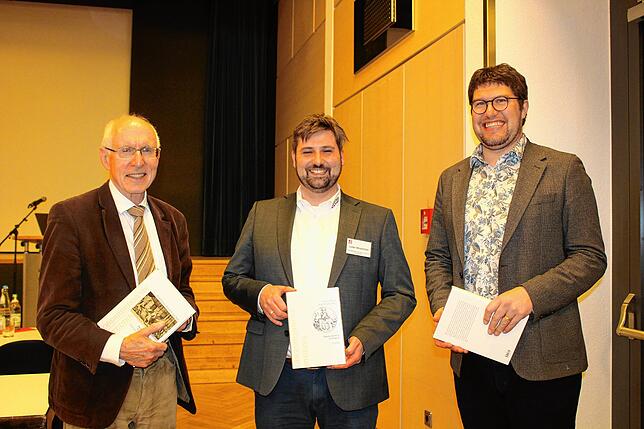
Weil die Stadt strategisch wichtig an den Marschrouten der Heere lag, die nördlich vom Bodensee ihren Weg suchten, war es nur eine Frage der Zeit, bis der Krieg hier ankommen würde. Drei Jahre nach Kriegsbeginn erreichten französische Truppen und die des mit ihnen verbündeten Kurfürsten Max Emmanuel von Bayern die Stadt. Mehrfach habe er über die Tapferkeit und Standhaftigkeit der Stockacher gelesen, die den bayerischen Kurfürsten erzürnt hätten, so Windmöller. Beim Abmarsch setzten die Truppen die Stadt in Brand, wodurch laut Ratsprotokoll vom 12. September 1705 innerhalb weniger Stunden „ohne den herrschaftlichen Pfarrhof und Frühmesshäuser und Salmannsweiler Hof“ ein Schaden von geschätzten 146.750 Gulden entstand. Laut Quellenangaben habe es nur noch 72 Bürger gegeben, berichtete Windmöller.
Die Stockacher waren auf sich selbst gestellt
Der Kaiser erließ zwar einige Steuern und Lasten und zeigte sich der treuen Stadt zugeneigt, doch musste sich Stockach größtenteils selbst helfen. Zur Verdeutlichung des Wiederaufbauprozesses betrachtete Julian Windmöller den Wiederaufbau zentraler Gebäude der Infrastruktur, den Brunnenbau und den Umgang mit der Stadtmauer. Er berichtete von ersten Einträgen in Tauf-, Sterbe- und Heiratsregistern und dokumentierten Bauschäden. Bald darauf entstanden der Neubau des ehemaligen Gasthaus Zum Weißen Kreuz, das als herrschaftliches Kanzleigebäude genutzt wurde, und das Rentamt. Der Bau des Marktbrunnens war notwendig für die Infrastruktur, diente aber auch der Repräsentation. Dass es offenbar keine Pläne von Häusern und Hofstätten gab, erklärt laut Windmöller, warum noch heute mancher Keller in der Oberstadt unter andere Gebäude reicht oder Teile mancher Gebäude nicht unterkellert sind.
Nach 1714 entstanden Rathaus, Metzig (Metzgerhaus), Ziegelofen, Waschhaus und der untere Brunnen. Wiederholte Brunnenerneuerungen und Reparaturen an Gebäuden und Straßen bezeugen, dass die Stadt nie aus dem Bauen rauskam und wegen stets knapper Kassen vermutlich nicht immer in gebotener Qualität bauen konnte. Der Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur war mühsam, langwierig und abgesehen von den herrschaftlichen Gebäuden eher funktional als repräsentativ.
Stadtmauer wird zum Steinbruch
Die Bürger nutzten Steine der kaputten Stadtmauer für den Wiederaufbau ihrer Häuser. Oft wurden Grund und Haus eigenmächtig vorteilhafter ausgestaltet und die noch stehende Stadtmauer als Rückwand genutzt. Erst nachdem die städtische Infrastruktur weitgehend wiederhergestellt worden war, wurde der Status Quo festgehalten und versucht, weitere Durchbrüche der Mauer für Fenster und Türen in geregeltere Bahnen zu lenken.

Zum Abschluss seines kurzweiligen Vortrags ging Julian Windmöller auf die Hochzeit der habsburgischen Kaiserinnentochter Maria Antonia mit dem französischen Thronfolger Ludwig-August, später Ludwig XVI, ein. Damit endete seine historische Betrachtung symbolisch mit der habsburgisch-französischen Versöhnung.
Eine wichtige Rolle bei der Versöhnung zweier Nationen
Die Brautfahrt von Wien nach Paris Anfang Mai 1770 war vorab ein regelrechter Modernisierungsmotor: Straßen wurden gerichtet, Rathaus, Ober- und Untertor renoviert, neue Laternen hergestellt und alle Einwohner angehalten, ihre Häuser zu weißeln. Aus den herrschaftlichen Häusern der Umgebung mussten allerlei Möbel und Ausstattungsgegenstände für ihre Unterbringung geliehen werden. Nach einigen Audienzen fand ein Abendessen mit anschließendem Kammerkonzert statt. Am nächsten Morgen reiste der Tross weiter. Julian Windmöller sagte: „Nach Wien wurde berichtet, dass in Stockach alles zu höchster Zufriedenheit abgelaufen sei.“ Im Ratsprotokoll aus dem Stadtarchiv stehe dagegen nur knapp, dass „der Durchmarsch Ihrer königlichen Hoheit Mariae Antoniae Erzherzogin von Österreich, zukünftiger Königin von Frankreich, glicklich vorbeygegangen“ war.
Konrad Krimm, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Geschichtliche Landeskunde am Oberrhein, dankte im Namen aller Teilnehmer für die anschauliche Schilderung. Kulturamtsleiterin Corinna Bruggaier lobte, Julian Windmöller habe gleichermaßen das Fachpublikum wie auch die interessierten Stockacher erreicht.









