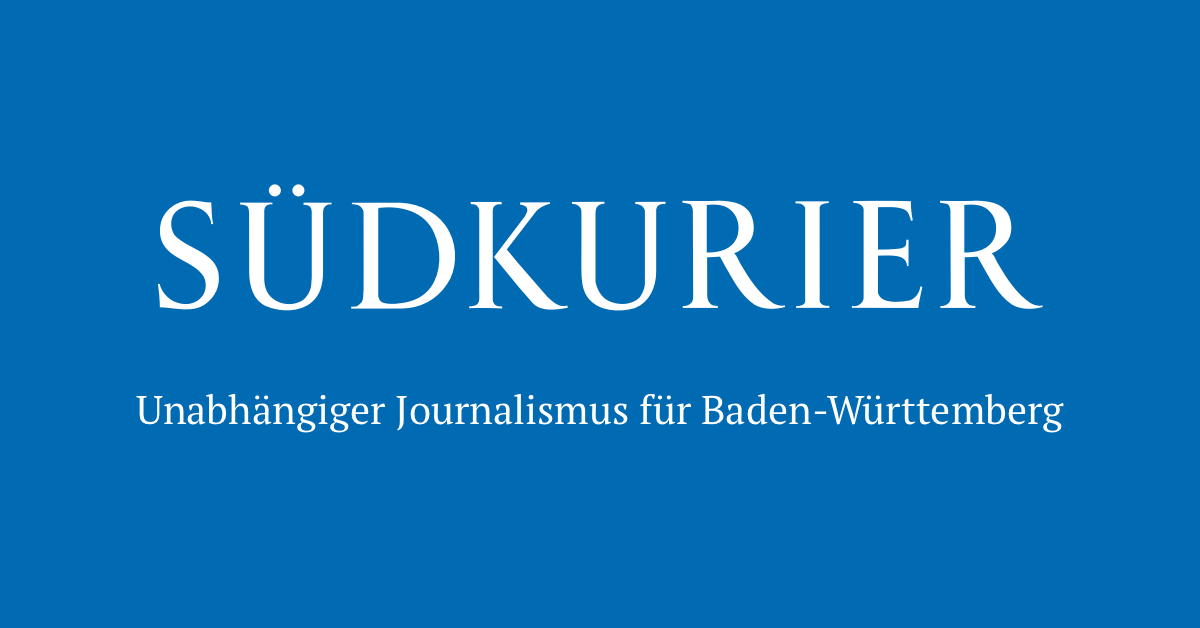Was zählt zu Heimatliteratur, welche Bedeutung kommt ihr und den Heimatbüchereien zu und welcher Gewinn kann daraus gezogen werden? Darüber sprachen der Schriftsteller Arnold Stadler, die Bibliothekarin Christina Thormann, der Journalist Christoph Wartenberg und der Historiker Edwin Ernst Weber im Kulturzentrum Alte Schule in Sigmaringen. In der Gesprächsrunde zeigte sich die Schwierigkeit, allein den Begriff Heimat zu definieren, der stark persönlich geprägt ist. Darüber hinaus entspann sich eine Diskussion über den Vorgang des Lesens sowie darüber, ob das Buch von den elektronischen Medien verdrängt wird. Arnold Stadler äußerte sich dahingehend unmissverständlich: „Ich kann einem Buch, das mit Strom verbunden ist, nichts abgewinnen.“
Deutung des Begriffs Heimat
Heimat ist sowohl ein geografischer als auch abstrakter Ort, der den Einzelnen erden kann, und zugleich ein schwieriger Begriff, wenn es um gesteigerte nationale Gefühle und mit ihnen verbundene Abgrenzungen geht, erfuhr das Publikum im Kulturzentrum Alte Schule bei der Frage nach der persönlichen Bedeutung des Begriffs, mit der Moderator Michael Hescheler, Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung in Sigmaringen, die Gesprächsrunde eröffnete. „Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle und wo ich keine Angst habe“, beschrieb Christina Thormann. Christoph Wartenberg hingegen erklärte: „Ich fühle mich als heimatloser Geselle.“ Es gebe für ihn keine Heimat und er sei auch in keinem Dialekt zu Hause. Obwohl er bereits 35 Jahre in Sigmaringen wohne, könnte er ohne Probleme an einen anderen Ort wechseln. „Ich fühle mich als Deutscher oder als Europäer“, gestand er jedoch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu. Arnold Stadler bestätigte ihn darin. Er selbst sei Weltbürger. Jeder Mensch habe das Recht auf Heimat. Der Schriftsteller fügte an: „Heimat ist ein Ort, nach dem ich Sehnsucht haben kann.“ Das könne auch die Sprache beziehungsweise der Dialekt sein. Edwin Ernst Weber ergänzte, dass für die ältere Generation der Hof ihre Heimat gewesen sei. Der Hof sei zugleich Aufgabe und Verpflichtung der Besitzer als auch der Nachkommen gewesen, von denen verlangt worden sei, die eigenen Berufswünsche zugunsten des Fortbestands des Hofes zurückzustellen.
Als Historiker und Direktor des Kreisarchivs gelten Webers Aktivitäten dem Ziel, dass die Menschen mehr über die Geschichte ihrer Heimat erfahren, sowohl über die Hintergründe als auch über die Abgründe, erläuterte er. Das diene dazu, „die Beheimatung der Menschen zu erleichtern“. Dabei bezog er sich nicht nur auf die in der Region aufgewachsene Bevölkerung, sondern auch auf Migranten, die hier eine Heimat gefunden haben.
Schlagwort Heimat in Bibliotheken nicht mehr attraktiv
Heimat als Schlagwort in der Bibliothek sei hingegen nicht mehr attraktiv, so die Leiterin der Sigmaringer Stadtbibliothek Christina Thormann. „Heimat“ klinge für die Nutzerinnen und Nutzer etwas antiquiert. Heimatromane würden als trivial wahrgenommen, weshalb die Bibliothek auf diese Kennzeichnung ganz verzichtet habe. Heimatliteratur werde zwar in größerem Umfang angeboten, diese sei unter dem Thema Region zu finden. Beliebt seien Reiseführer, Kochbücher mit schwäbischen Rezepten, Mundart-Bände, Stadtgeschichte und Regional-Krimis.
Heimatliteratur kein Privileg des ländlichen Raums
Arnold Stadler betonte vehement, dass Heimatliteratur kein Privileg des ländlichen Raums sei. „Das gibt es auch in Berlin“, erklärte er. „Berlin Alexanderplatz“ von Alfred Döblin sei ein Heimatroman, ebenso wie die „Buddenbrooks“ von Thomas Mann für Lübeck. Auch das Lesen und das Hineinvertiefen in ein Buch könne Heimat bieten, gerade wenn man sich mit sich und dem Buch in Einklang befinde. Darüber war sich die Gesprächsrunde einig. „Nach jedem guten Buch muss die Welt etwas anders sein“, beschrieb Stadler.
Region reich an Literatur
Die oberschwäbische Region sei reich an Literatur, betonte Weber. „Wenn man in der Geschichte weiter zurückgeht, ist sie sogar schwerreich“, ergänzte Stadler. Die Autoren, Prediger und Philosophen hätten stark auf die Umgangssprache der Region eingewirkt. Edwin Ernst Weber würdigte darüber hinaus die kleinen Stadt-, Pfarr- und Dorfbibliotheken, die ein „Tor zur Bildung“ und damit ein „Tor zur Welt“ gewesen seien und immer noch sind, wie er aus eigener Erfahrung wisse. Im Anschluss der Gesprächsrunde beteiligte sich das Publikum mit Fragen und Anregungen an der Diskussion.