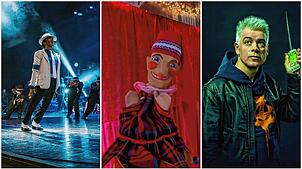Die Corona-Pandemie hat von den Menschen in den vergangenen eineinhalb Jahren viel abverlangt. Insbesondere die Lockdown-Phasen im Frühjahr und über den Herbst und Winter, wo das gesellschaftliche Leben über Wochen komplett herunter gefahren wurde, und selbst private Treffen nur in Ausnahmefällen erlaubt waren und die Menschen zur Isolation gezwungen wurden, schlugen aufs Gemüt und ließen die Stimmung bei vielen Menschen in den Keller rutschen.
„Vieles an Möglichkeiten ist ja auf einmal weggebrochen.“Stefan Plaaß, Leiter einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depressionen
Besonders zu schaffen machte diese Zeit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Stefan Plaaß, Gründer einer Selbsthilfegruppe für Menschen mit Depression und selbst Betroffener, schildert im Gespräch mit unserer Zeitung, wie er andere Betroffene unterstützt hat und was er dagegen unternommen hat, dass ihn diese Zeit nicht vollends aus der Spur geworfen hat.
„Corona hat es nicht einfacher gemacht“, sagt Stefan Plaaß, der weiß, dass die vergangenen Monate an vielen Menschen nicht spurlos vorüber gegangen sind. Vor allem auch junge Menschen hätten unter der Situation sehr gelitten, sagt er. Für sich selbst hat der 60-Jährige ein Rezept gefunden, mit der Situation umzugehen. „Nicht zu viel Medien schauen und viel Sport machen“, beschreibt Stefan Plaaß, wie er die schwierigen Monate überstanden hat. Da andere Möglichkeiten der körperlichen Betätigung ausgeschlossen waren, hat er die Natur für sich neu entdeckt und viel Zeit beim Nordic Walking im Wald verbracht.
Viele Möglichkeiten fielen weg
Andere hätten es da ungleich schwerer gehabt. „Vieles an Möglichkeiten ist ja auf einmal weggebrochen. Wer beispielsweise regelmäßig schwimmen gegangen ist, und konnte dies nicht, weil die Schwimmbäder geschlossen hatten, musste damit klarkommen. Wer das nicht geschafft hat, hat sich unter Umständen noch mehr zurückgezogen.“
Auf Online-Treffen hat die Gruppe verzichtet
Da auch die Treffen der Selbsthilfegruppe in Präsenz längere Zeit nicht möglich waren, hat Stefan Plaaß der Gruppe, die er unter dem vielfältigen Angebot der Wirkstatt betreibt, virtuelle Treffen über Online-Konferenzen angeboten. „Doch das wollten die Gruppenmitglieder nicht.“ Plaaß bot daraufhin an, für einzelne Gespräche jederzeit zur Verfügung zu stehen. „Das wurde vereinzelt angenommen, sodass wir eigentlich sporadisch in Kontakt standen.“

Zwar erlaubte der Gesetzgeber, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen schneller als andere wieder zu Gruppengesprächen treffen konnten. Doch dann stand Plaaß vor einem anderen Problem. „Der Raum in der Wirkstatt war zu klein, um die Abstandsregeln einzuhalten.“ Immerhin besteht die Selbsthilfegruppe aus bis zu 13 Betroffenen. Nach langer Suche bekam Plaaß geeignete Räumlichkeiten im Ökumenischen Gemeindezentrum auf der Seebauernhöhe zur Verfügung gestellt.
Seit vier Monaten können sich die Mitglieder dort wieder zu regelmäßigen Gesprächsrunden treffen, die einmal im Monat stattfinden. Und wie haben die anderen Gruppenmitglieder die Zeit überstanden? „Wir lachen und wir weinen zusammen“, beschreibt Plaaß die Situation nur kurz. Was er bedauert ist, dass junge Menschen sich offenbar nicht trauen, den Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe zu suchen. Auch plädiert er dafür, dass junge Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich schneller einen Therapieplatz in einer stationären Einrichtung bekommen. Plaaß freut sich, dass in Königsfeld mit der Eröffnung der Klinik am Doniswald demnächst wieder eine zusätzliche Einrichtung zur Verfügung steht.
Immerhin ist niemand abgeglitten
Auch er habe in der Pandemie-Zeit gemerkt, wie wichtig die Selbsthilfegruppe für ihn persönlich ist, die er vor acht Jahren ins Leben rief und die er nach wie vor leitet, auch wenn er inzwischen im Raum Schramberg wohnt. „Der Bedarf ist nach wie vor da.“ Immerhin habe es keine Fälle gegeben, wo die ihm bekannten Betroffenen etwa in eine Spiel- oder Alkoholsucht abgeglitten seien.