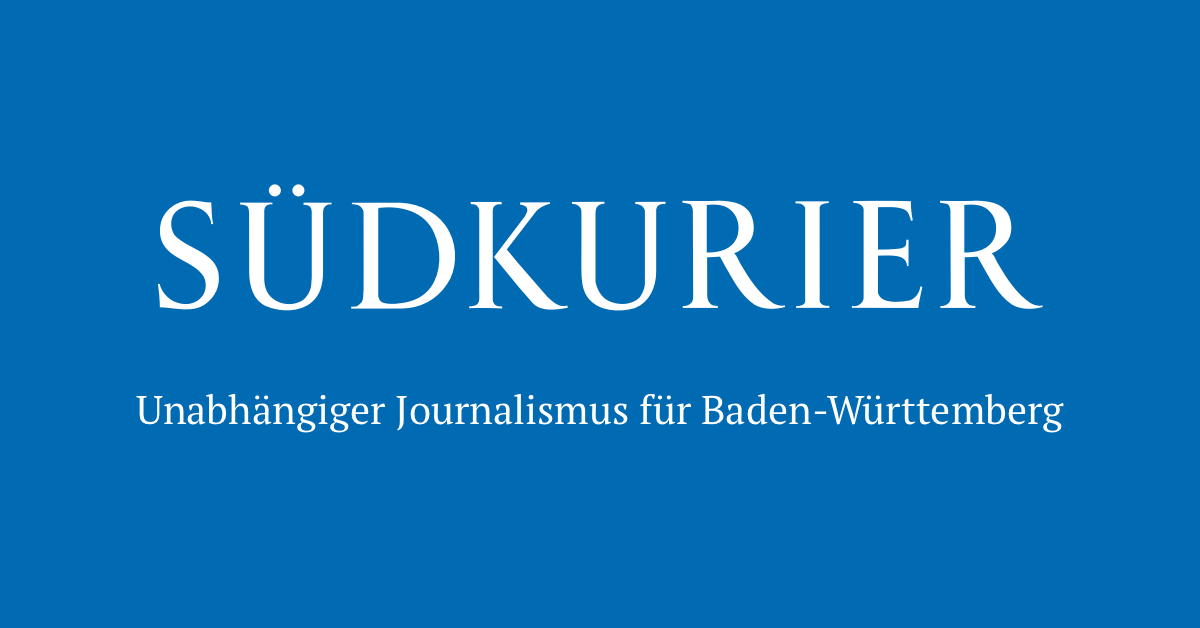Im Idealfall werden Lebensmittel so lokal wie möglich hergestellt und gekauft. Würde nichts importiert, wäre in einem kleinen Binnenland wie der Schweiz die Auswahl an Produkten aber sehr viel kleiner, als man es sich heute, in der globalisierten Welt, gewohnt ist. Mit ausgeklügelter Organisation und genügend finanziellen Ressourcen ist aber vieles möglich: wie zum Beispiel im Aargau Crevetten zu züchten.
Die Firma Swiss Shrimp hat dafür quasi ein künstliches Meer erschaffen. In einer 4200 Quadratmeter großen Halle bei den Salinen zwischen Rheinfelden und Möhlin stehen heute 16 Salzwasserbecken mit perfekt auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmtem, in einer Kreislaufanlage durchgehend biologisch gesäubertem Wasser. In jedem Becken wachsen 150‘000 Larven zu ausgewachsenen Crevetten heran. Eine Million sind es normalerweise insgesamt.
Eine große Solaranlage auf dem Hallendach sorgt für den nötigen Strom. Die Abwärme und das Salz für die Wasserbecken stammen aus den benachbarten Salinen. Swiss Shrimp will konsequent nachhaltig produzieren, verzichtet zu 100 Prozent auf Antibiotika und erhält dafür viel Beachtung und Lob. Die Firma ist erfolgreich unterwegs, inzwischen beziehen viele Gastrolokale hierzulande Crevetten von Swiss Shrimp. Vor allem an Weihnachten sind die Bestände immer wieder ausverkauft.

Wo viel gelobt wird, gibt es aber oft auch Kritik. Dass Firmengründer Rafael Waber in einem Beitrag im Schweizer Fernsehen die ansonsten importierten Crevetten aus Asien bezüglich des Beifangs von Fischen, der „sehr hohen CO2-Emissionen“ oder des Einsatzes von Antibiotika bemängelt hatte, stieß einem AZ-Leser sauer auf. Er meldete sich bei der Zeitung mit der Absicht, die Betriebe in Südostasien in Schutz zu nehmen, wie er sagt.
Direkt gegen die Produktion von Swiss Shrimp habe er zwar nichts – „es ist und bleibt ein fantastisches Produkt“, sagt er. Doch wenn schon die negativen Aspekte der Crevetten aus Asien angeprangert werden, sollte auch die andere Seite hinterfragt werden, findet er. Swiss Shrimp wirft er sogenanntes „Greenwashing“ vor – also, dass sich das Unternehmen ein grünes, nachhaltiges Image gebe, das in Wirklichkeit nicht ganz so nachhaltig sei.
So seien laut dem Leser die Mengen in Rheinfelden zu gering, als dass die Produktion nur mit nachhaltiger Energie und die Zufütterung nur aus nachhaltigen Quellen möglich seien. Er bezweifelt weiter, dass keine Antibiotika beigesteuert werden, oder vermutet den Einsatz chemischer Stoffe.
Landverbrauch und CO2-Ausstoß seien in Asien problematischer
Rafael Waber nimmt auf Anfrage zu den bemängelten Punkten Stellung. Betreffend Nachhaltigkeit hebt er hervor, dass die relevanten Emissionstreiber zu Beginn von Swiss Shrimp in einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz analysiert worden sind. Am meisten Emissionsunterschiede gebe es beim Landverbrauch: Die Abholzung von Mangrovenwäldern zugunsten von Shrimp-Farmen in Asien sei noch viel problematischer als die von Regenwäldern, sagt er. Weiter würden in Asien fossile Brennstoffe eingesetzt, in Rheinfelden hingegen nicht.
Betreffend Futter wurde behauptet, das allermeiste stamme nicht aus der Schweiz, sondern aus der EU. Diese Aussage kontert Swiss Shrimp nicht. Die EU liegt denn auch nahe, die Produktionshalle in Rheinfelden befindet sich eineinhalb Kilometer Luftlinie von Deutschland entfernt. Die Crevetten erhalten Futter aus pflanzlichen Zutaten, Fischmehl und -öl. Das Futter werde von einer Genossenschaft in Frankreich hergestellt und sei teurer als konventionelle Produkte, dafür aber qualitativ besser.
Ein Antioxidans braucht es aber
Antibiotika setzt Swiss Shrimp keine ein, bekräftigt Rafael Waber. Man setze dafür auf kontinuierlich gereinigtes Wasser. „Wir setzen unter anderem auf einen Biofilter, der sich nur mithilfe von Bakterien betreiben lässt. Würden wir Antibiotika einsetzen, würde diese biologische Filterstufe sofort kollabieren.“ In Open-Air-Aquakulturen in Übersee gelangten Bakterien oder Viren via Kot von herumfliegenden Vögeln ins Wasser.
Was den Einsatz chemischer Stoffe betrifft, bestätigt Waber aber den Einsatz des Lebensmittelzusatzstoffes E 586. Mit folgendem Grund: Alle Krebstierarten, wie auch die Crevetten von Swiss Shrimp, haben ein Enzym, das bei Verletzungen einen schwarzen Farbstoff bildet, der Wunden versiegelt. Nach dem Tod eines Krebstieres, färbt sich das Tier deshalb aber am ganzen Körper schwarz.
Für den Konsum ist dies unbedenklich, doch die Tiere sehen ziemlich unappetitlich aus. E 586 (4-Hexylresorcin) blockiert dieses Enzym, das die Tiere schwarz färbt. Andere Produzenten benützen laut Rafael Waber gegen die Schwarzfärbung den Stoff E 223 (Natriummetabisulfit), der aber teilweise Allergien auslöst – E 586 hingegen offenbar nicht.
„Wir sind sehr darum bemüht, dieses Antioxidans in so geringen Konzentrationen wie nur möglich einzusetzen, damit der Kunde den vollen Genuss unserer Delikatesse erleben kann“, so Waber. Es sei der einzige Stoff, den Swiss Shrimp einsetze. Sulfite, wie bei importierten, tiefgefrorenen Crevetten, seien bei den frischen Crevetten aus Rheinfelden zum Beispiel tabu.
Die Frische sei es denn auch, was die hiesige Produktion von jener aus Übersee abhebt. Aktuell werden mehrere Hundert Kilo Crevetten pro Woche geerntet. Für die Nachfrage in der Schweiz, vor allem aus der Gastronomie, reiche dies noch nicht aus. Rund 80 Prozent der in der Schweiz verzehrten Crevetten stammen nach wie vor aus Asien. In drei bis vier Jahren will Swiss Shrimp jede Woche 1,5 Tonnen Crevetten in der Woche ausliefern können. Auch eine Expansion ins Ausland ist ein Thema.
Der Autor schreibt für die „Aargauer Zeitung“. Dort ist der Artikel auch zuerst erschienen.