Das PSI hat große Erfahrung mit Protonentherapie und behandelt damit schon seit 1996 Patienten mit Tumoren im Hals und Kopfbereich sowie am Körperstamm. Neu kommen jetzt – im Rahmen der Studie – auch inoperable Lungentumore dazu, wie das PSI informiert. Von dem Einsatz der besonders schonenden und präzisen Bestrahlungsart bei Lungenkrebs erhoffen sich die Ärzte weniger Nebenwirkungen am gesunden Lungengewebe und am Herz.
Doch nicht alle Tumore in der Lunge lassen sich durch eine Operation entfernen. Forschende versuchen deshalb intensiv, die nicht-operativen Behandlungsmethoden zu verbessern. Für Patienten in der Schweiz ist am Paul-Scherrer-Institut PSI jetzt eine neue Option hinzugekommen: Bestrahlung mit Protonen. Damit wollen PSI-Forschende die Überlebenszeit für die Patienten auch ohne Tumorentfernung verlängern und strahlentherapiebedingte Nebenwirkungen am Herz sowie Lungenentzündungen vermindern.
Teilnahme an internationale Studie

„Im Rahmen einer internationalen Phase-3-Studie haben wir heute die erste Patientin mit Lungenkrebs, genauer einem nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom, mittels Protonentherapie behandelt“, sagt Damien Weber, der Chefarzt und Leiter des Protonentherapiezentrums am PSI. „Die Patientin hat einen Tumor im fortgeschrittenen Stadium, der nicht operiert werden konnte.“
Die Studie wird von der amerikanischen Organisation für klinische Studien NRG Oncology geleitet. Das PSI nimmt gemeinsam mit dem Radio-Onkologie-Zentrum der Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) an der Studie teil – als einzige Einrichtungen ausserhalb der USA. Die Studie vergleicht den Behandlungserfolg von herkömmlicher Strahlentherapie mit der von Protonentherapie beim nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinom – der häufigsten Form von Lungenkrebs – im fortgeschrittenen, inoperablen Stadium.
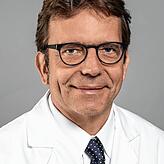
„Dass unser Radio-Onkologie-Zentrum und das PSI an der Studie mitwirken dürfen, ist nur aufgrund der langjährigen Expertise unserer beiden Einrichtungen auf dem Gebiet der Strahlentherapie und unserer Mitgliedschaft bei NRG Oncology möglich“, sagt Oliver Riesterer, der Chefarzt des Radio-Onkologie-Zentrums Aarau und Baden.
„Wir können unseren Krebspatienten hier eine einzigartige Möglichkeit anbieten: die Teilnahme an der ersten Studie in der Schweiz, die Protonentherapie und herkömmliche Strahlentherapie randomisiert vergleicht.“ Die Zuteilung der Patienten erfolgt per Losverfahren: Einige werden mit Protonen am PSI bestrahlt, andere wie bisher mit Röntgenstrahlen am Radio-Onkologie-Zentrum KSA-KSB. „Da wir die modernsten Geräte haben, die es derzeit für die klassische Strahlentherapie gibt, vergleichen wir das Beste mit dem Besten“, freut sich Riesterer über den Studienstart.
Bevor die Studie überhaupt starten durfte, musste sich das PSI – wie alle teilnehmenden Einrichtungen einschließlich dem Radio-Onkologie-Zentrum der beiden Kantonsspitäler – aufwendig durch das von NRG Oncology beauftragte M.D. Anderson Cancer Center in Houston akkreditieren lassen. „Um die Daten vergleichen zu können, muss man sicherstellen, dass alle Patienten in allen 30 Studienzentren auf dieselbe Weise und mit der gleichen Qualität behandelt werden“, erklärt der Radioonkologe Dominic Leiser vom PSI.
„So mussten wir unter anderem nachweisen, dass wir einen Tumor in einer Patienten-Attrappe bis auf zwei Millimeter genau treffen und dass dort auch genau die Dosis ankommt, die wir vorher berechnet haben.“ Für die geforderte Qualitätskontrolle hat das PSI-Team Bestrahlungen an sogenannten Phantomen durchgeführt. Diese Messattrappen haben eingebaute Dosis-Messgeräte und ahmen die Eigenschaften eines echten Patienten nach, sogar die Lungenbewegung kann simuliert werden.
Ein grosser Schritt für die Protonentherapie
Mit der Protonenbestrahlung eines Patienten mit Lungenkrebs wird am PSI das nächste Kapitel der Protonentherapie aufgeschlagen. Während sich die Protonentherapie bei bestimmten Tumoren im Kopf- und Halsbereich sowie am Körperstamm bereits etabliert hat, sind Tumore in der Lunge noch Neuland.
Insgesamt sollen in die Studie 330 Patienten eingeschlossen werden, etwa zehn davon in der Schweiz. „Die Zusammenarbeit unserer beiden Institutionen ist ein Meilenstein für die Krebspatienten im Kanton Aargau“, sagt Weber. Auch in anderen Projekten wollen die beiden Einrichtungen künftig enger zusammenarbeiten. Riesterer betont: „Unser Ziel ist es, Photonen- und Protonentherapie bestmöglich zum Wohle unserer Patienten einzusetzen.“




