So nah und doch so fern: Die Schweiz liegt um die Ecke, aber das Schweizer Fernsehen ist für viele am Hochrhein unerreichbar. Ob „SRF bi de Lüt“, „10 vor 10“, „Samschtig-Jass“ oder die Wettervorschau: Zuvor vertraute Sendungen sind von der Mattscheibe verschwunden. Und das seit einem bestimmten Tag, dem 3. Juni 2019. Die Schweizer Radio- und Fernsehgemeinschaft (SRG) schaltete zu diesem Datum das DVB-T-Signal, das digitale Antennenfernsehen, ab. Aus „wirtschaftlichen und technologischen Gründen“, wie Simon Blumer von der SRG-Kommunikation ausführt. Der Empfangsweg via Antenne sei in der Schweiz nur noch von rund 1,5 Prozent der Haushalte genutzt worden. Die damit verbundenen Infrastruktur- und Betriebskosten waren der SRG zu hoch geworden.
Extra Entschlüsselung gibt es nur für Schweizer
Für die deutsche Grenzregion aber hieß das, dass SRF 1 und 2 nicht mehr zu empfangen waren, weder via Antenne noch über Kabel. Allein der Sender SRF Info blieb als zeitweise unverschlüsseltes Auslandsprogramm frei via Satellit empfangbar. Wobei: Auch die Kanäle SRF 1 und 2 dringen weiterhin über die Grenze. Aber in der Grenzregion lebende Deutsche haben nichts davon. Denn beide werden per Satellit und verschlüsselt übertragen.
Und nur in Deutschland lebende Auslandsschweizerinnen und -schweizer bekommen die zur Entschlüsselung notwendige sogenannte Sat-Access-Karte ausgehändigt.
Politiker wollen sich für den Empfang einsetzen
Es war 2019 ein herber Verlust, gerade am Hochrhein: Ist das eidgenössische Fernsehen doch „für viele Menschen in unserer Region ein wichtiger Teil des kulturellen Austauschs mit den Nachbarn“, wie die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter sagt. 1962 geboren, ist sie mit Schweizer Fernsehen und Radio groß geworden. Sie betont: „Beides gehörte für uns in der Grenzregion einfach dazu. Wenn ich heute noch die Stimme von Beni Thurnheer höre, dann ist das für mich sofort: Schweizer Fernsehen.“ Auch ihrem CDU-Kollegen Felix Schreiner liegt das schweizerische Fernsehen am Herzen, als „Teil des gemeinsamen Grenz- aber auch Kulturraumes“ am Hochrhein.
So waren beide über den Schritt der SRF vor sechs Jahren besorgt und setzten sich für einen Weiterbetrieb ein. „Doch für die SRG kam ein Weiterbetrieb der Sendemasten nicht infrage“, wie Schreiner noch weiß. Schwarzelühr-Sutter erfuhr in Gesprächen, dass „der finanzielle und rechtliche Spielraum“ für einen solchen Weiterbetrieb in der Schweiz „begrenzt“ war. Heute sagt sie: „Ich freue mich, dass Schweizer Fernsehen im südbadischen Raum wieder empfangen werden kann.“
Wo sind Schweizer Sender zu empfangen?
Das ist tatsächlich wieder möglich, wenn auch mit Einschränkungen. Möglich wurde es, nachdem das vorarlbergische Unternehmen Lampert den früheren SRG-Sendemast auf dem 1800-Meter-Gipfel Hoher Kasten in den Schweizer Alpen übernommen hatte und seitdem das von ihm abgestrahlte TV-Signal ins eigene Kabelnetz einspeist. Darauf bauten die Stadtwerke Konstanz auf. Dank der Kooperation mit den Österreichern kehrte so auch am deutschen Bodensee-Ufer Schweizer Fernsehen zurück.
Und weil die Stadtwerke Konstanz wiederum mit den Stadtwerken Waldshut-Tiengen (STW) zusammenarbeiten, ist eine weitere Insel für den Empfang Schweizer Fernsehens am Hochrhein entstanden, eben in der Doppelstadt. Schon im Paket „STW-TV Basis“ sind die Schweizer Fernsehsender SRF1, SRF 2 und SRF Info mit drin – Glasfaseranschluss vorausgesetzt.
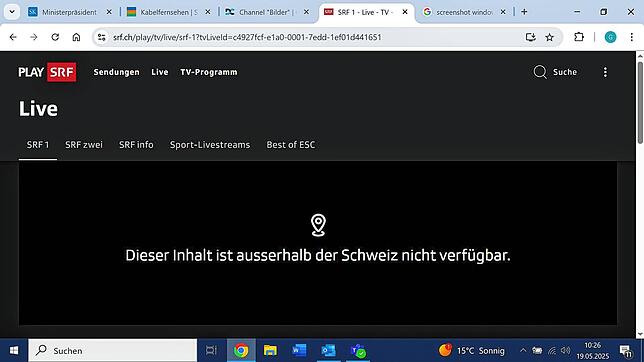
Etwa zeitgleich mit den Stadtwerken Konstanz sprang auch der regionale Internet- und Kabel-TV-Anbieter Stiegeler aus Schönau auf den Zug auf und verspricht für sein Kabelfernsehen: „Schweizer Sender in Grenznähe inklusive.“ Und wenn auch das Versorgungsgebiet des Unternehmens weit über die Region hinausreicht, lebt der Großteil der Stiegeler-Fernsehkunden eben in dieser Grenznähe, in den Postleitzahl-Bereichen 78 und 79. Außerhalb von Südbaden sei das Interesse an Schweizer Fernsehen ohnehin gering ausgeprägt, merkt Geschäftsführer Felix Stiegeler an.
Einige Sendungen werden dennoch verschlüsselt
Zwar erlaubten die Schweizer aus lizenzrechtlichen Gründen nicht, dass sämtliche Sendungen in Deutschland mit ausgestrahlt werden dürfen, beispielsweise bei internationalen Sportevents wie Formel 1, Champions League oder Wimbledon, erklärt Stiegeler. In solchen Fällen müssten diese dann „schwarz geschaltet“, also verschlüsselt werden. Sonst aber dulde die SRG die Ausstrahlung ihrer Sender im deutschen Ausland.
Große Unternehmen sind zurückhaltend
Relativ kleine Zielgruppe allein schon in Baden-Württemberg – wohl mit ein Grund, warum große Kabelnetzunternehmen wie etwa Vodafone in Sachen Schweizer Fernsehen eher zurückhaltend sind. Wenn auch sie mit Lampert zusammenarbeiten und das TV-Signal vom Hohen Kasten in ihr Netz einspeisen würden, könnten sie den Empfang Schweizer Sender in großem Stil möglich machen.
„Wir haben 2019 nach Lösungen gesucht, aber die SRG konnte aus lizenzrechtlichen Gründen keine Smartcards zur Entschlüsselung des Satellitensignals an Firmen oder Personen außerhalb der Schweiz abgeben“, erklärt Vodafone-Sprecher Helge Buchheister. Der einzige Schweizer Sender, den Vodafone noch ins eigene Kabelnetz einspeist, ist der Regionalsender Telebasel. „Grundlage ist ein Einspeisevertrag, den wir mit dem Sender abgeschlossen haben“, so Buchheister Telebasel sei frei empfangbar, allerdings nur im Umkreis von Lörrach.
SRG hat kein Interesse an Zuschauern in Deutschland
Auch die SRG kann und will nicht dazu beitragen, dass ihre TV-Programme im Ausland wieder großflächig zu empfangen sind. Dazu haben sie auch kein Mandat. „Die SRG hat den gesetzlichen Auftrag, die Bevölkerung in der Schweiz zu versorgen. Eine Ausweitung ins Ausland, etwa nach Deutschland, ist nicht vorgesehen und aus lizenzrechtlichen Gründen auch nicht möglich“, erklärt Blumer.
Die Entscheidung über eine Einspeisung der SRF-Programme in deutsche Kabelnetze liege ausschließlich bei deutschen Kabelnetzbetreibern. Doch Simon Tauscher von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg antwortet auf die Frage, ob sich an der Gesamtsituation des Empfangs Schweizer Fernsehsender in Deutschland irgendwann einmal wieder etwas ändern wird: „Davon ist aktuell nicht auszugehen.“







