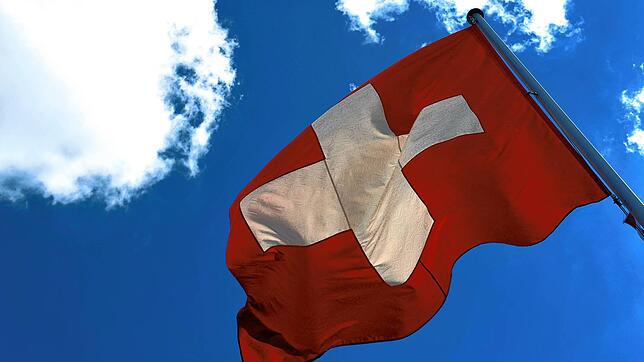An der Kasse eines Zürcher Theaters hing lange der Spruch von Karl Valentin: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“ Klingt gut. Klingt beruhigend: Du musst dich als Ausländer nicht fremd fühlen. Meine Erfahrung ist eine andere. Obwohl ich als Deutsche über 30 Jahre in der Schweiz arbeitete und zeitweise auch wohnte, habe ich mich bis zuletzt ein bisschen fremd gefühlt.
Es ist wie mit der Liebe. Je näher man sich kennt, desto mehr versteht man einander, desto spürbarer werden allerdings auch die feinen Unterschiede. Obwohl ich als Kulturredakteurin der Basler Zeitung den gleichen Lohn bekam wie meine Kollegen, kam ich mich in der reichen Schweiz immer ein wenig arm vor. Hin- und hergerissen zwischen zwei Systemen.
Die Schweiz gilt europapolitisch als Rosinenpickerin, sie sucht das Beste für sich heraus. Aber sind nicht alle Politiker an erster Stelle ihrem eigenen Land verpflichtet? Und bin nicht ich die ärgste Rosinenpickerin, wenn ich meine Franken-Rente am Wohnort Freiburg ausgebe?
Ja, die Schweiz hat in der Nazizeit nicht alle Flüchtlinge aufgenommen, aber ausschlaggebend ist: Die Schweiz hat keinen Weltkrieg entfesselt, sie hat nicht Millionen Menschen im KZ umgebracht. Ja, die Schweiz gilt als ausländerfeindlich. Aber ich persönlich habe – in meiner eingestanden privilegierten Position – nie Diskriminierung erfahren.
Es war 1988 einfach, eine Bewilligung für Aufenthalt, Niederlassung und Arbeit zu bekommen, obwohl es Kontingente gab, auch für Deutsche. Ich fand Freunde und rückhaltlose Unterstützung bei Kollegen. Was als Irritation bleibt: Die Schweizer wissen, dass Ausländer nicht aus Liebe zur Eidgenossenschaft kommen, sondern wegen der Verdienstmöglichkeiten und Lebensqualität. Ja, es ist überraschend, was man in der Fremde erlebt.
Erste Überraschung
Die Schweiz ist kaum größer als Baden-Württemberg. Die Landesfläche der Schweiz ist zwar 6000 Quadratkilometer größer, allerdings besteht mehr als die Hälfte aus Alpen, ist also produktiv kaum nutzbar. Das deutsche Bundesland hat rund elf Millionen Einwohner, die Eidgenossenschaft rund neun Millionen. Statt als Deutscher die kleine Schweiz zu belächeln, sollte man sie für ihre politische, wirtschaftliche und zivile Kraft bewundern. Schade, dass das Schweizer Fernsehen nicht mehr in Deutschland zu empfangen ist.
Zweite Überraschung
Die Schweiz ist eine geteilte Nation. Was ich beim Autofahren lernte: Manche Verkehrsregeln können für den einen Kanton gelten, für den Nachbarkanton nicht. Und die Teilung reicht tiefer. Es gibt vier Landessprachen und drei sehr unterschiedliche Kulturkreise, deutsch, französisch, italienisch. Für Deutsche ist die Eidgenossenschaft identisch mit der Deutschschweiz. Heidiland also, Schokolade, Präzisionsuhren, Kuhglocken. Nichts könnte falscher sein.
Die Schweiz ist viel mehr: Pariser Leben in Genf, italienisches Flair im Tessin, Rätoromanisch in Graubünden. Jeder redet, lebt, arbeitet und wählt auf seine Art. Die Uhren-Metropole Biel (Bienne) ist zweisprachig. Von Basel über den Jurabogen bis nach Genf zieht sich eine Art Banane; hier wird eher links abgestimmt. Und man versteht einander trotzdem. Wenn überhaupt ein einzelnes Land, dann könnte die Schweiz Vorbild für ein neues Europa werden.
Dritte Überraschung
Nicht jeder Deutschschweizer kann „richtig“ deutsch. Die kleinen Kinder meiner Basler Freunde, obwohl an der Grenze lebend, verstanden mein Hochdeutsch nicht. Sie kannten nur Baseldeutsch. Erst in der Schule wird Hochdeutsch gelernt. Als Sprache des Verstandes, nicht als jene des Herzens.
Der Basler ist genervt, wenn etwa ein Zürcher das Baseldeutsche imitiert. Am peinlichsten aber ist es, wenn ein Deutscher versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen. So dummbatzig, wie wenn ein Bayer die Sachsen nachäfft. Es gilt: Sprache ist Heimat und schafft spontan Vertrauen als Nachweis von Herkunft.
Vierte Überraschung
Die Schweiz tickt international. Ein Basler Kollege ist mit einer Finnin verheiratet, ein anderer hat eine Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine aufgenommen. Nach 1950 wurden politische Flüchtlinge von der Bevölkerung überwiegend freundlich begrüßt, Tibeter, Ungarn, Tschechen, Slowaken und Tamilen.
In Basler Kinos laufen ausländische Filme in Originalsprache mit deutschen Untertiteln. Das hilft beim Englischlernen. In großen Pharma-Konzernen ist die Unternehmenssprache durchweg englisch. Weltbekannte Schweizer Firmen wurden von Immigranten gegründet: Nestlé (Deutschland), Maggi (Italien) oder Ciba (Frankreich). In Randstädten wie Basel und Genf betrug der Ausländeranteil schon um 1900 über 30 Prozent.
Fünfte Überraschung
Die Schweiz ist Mitglied des Schengen-Raums und hat ein Freizügigkeitsabkommen mit der EU, welches die Zuwanderung aus der EU erleichtert. Eine Volksinitiative setzte allerdings in der Verfassung durch, dass die Schweiz die Einwanderung eigenständig steuert. Ende 2024 lag der Ausländeranteil an der ständigen Wohnbevölkerung bei 27,4 Prozent, Tendenz steigend (Deutschland 15 Prozent).
Wobei der hohe Anteil in der Schweizer Statistik sich auch dadurch erklärt, dass es schwierig ist, eingebürgert zu werden. Dabei ist die Zunahme der Produktivität unter anderem auf Ausländer zurückzuführen. Einerseits. Andererseits fürchten sich Schweizer vor Lohndumping, Wohnungsnot, Ausnutzung der Sozialversicherungssysteme und Überfremdung. Muslima und Schwarzafrikaner wirken immer noch sehr fremd. Bislang ging es um Verschleierungsverbot und Minarette. Aber Migrationsdruck und Verteilungskämpfe werden härter. Die nationalkonservative SVP ist schon jetzt mit fast 29 Prozent die stärkste Partei.
Sechste Überraschung
Die Schweiz hat eine hohe Streitkultur. Man muss die Eidgenossen nicht kritisieren, das erledigen sie schon von alleine. Debatten, die ich unter vielen anderen mitverfolgen konnte: Pro und Contra zum EU-Beitritt, Nazi-Raubgold, Bankgeheimnis, NS-Raubkunst, Opernhaus-Krawalle, Fichen-Skandal, Tier- und Naturschutz, die (fast erfolgreiche) Volksinitiative zur Abschaffung der Armee 1989, Beibehaltung der Radio- und Fernsehgebühren 2018, Besteuerung großer Unternehmensgruppen 2023, Frauenstreik 2025.
Immer wieder ein Thema: die Rentenreform. Während Deutschland sinniert, ob Beamte in die Rentenversicherung aufgenommen werden sollen, hat die Schweiz das Beamtentum seit 2000 abgeschafft. Lehrer zum Beispiel sind Angestellte der Schulgemeinde. Geht doch.
Mein Schlüsselerlebnis, als ich die TV-Diskussionssendung „Arena“ sah: wie beinhart es hier zur Sache geht – auch in der Bevölkerung. Das hat seinen Grund. Jeder Stimmberechtigte hat qua Volksabstimmung direkten politischen Einfluss, kommunal, kantonal, national. Grob gesagt: Eine Volksinitiative kann neue Gesetze oder Beschlüsse verlangen; ein Referendum kann parlamentarische Beschlüsse ablehnen.
In Deutschland scheut man aufgrund der Erfahrungen mit der NS-Zeit die Stimme des Volkes. Anders in der Eidgenossenschaft. Weil das Volk über einzelne Themen abstimmt und seine Beschlüsse politisch umgesetzt werden, ist man motiviert, sich eine qualifiziertere Meinung zu bilden. Ein Abstimmungsbüchlein liefert sachliche Informationen.
Die Schweiz zu erleben, das heißt, von der Schweiz zu lernen. Sie ist die älteste stabile Demokratie in Europa, verfassungsmäßig 1848 entstanden, damals umringt von Monarchien. Ein kulturell dreigeteiltes Land wie die Eidgenossenschaft kann keinen ethnischen Volksbegriff wie die AfD entwickeln. Sie ist eher zu begreifen als Willensnation, als politische Gemeinschaft, abgesichert durch ein funktionierendes Sozialsystem, basierend auf einer florierenden Wirtschaft – noch.
Das kleine Land ist voller Widersprüche. Einerseits gibt es vier Sprachen, andererseits lernt man sie nicht alle in der Schule; im Parlament wird simultan übersetzt. Einerseits wurde das Frauenstimmrecht auf Bundesebene erst 1971 eingeführt, andererseits konnte die Sozialistin Rosa Luxemburg schon 1889 an der Uni Zürich studieren.
Einerseits wirkt die Mentalität bäuerlich-bürgerlich; andererseits ist man einer der größten Rohstoffhandel- und Finanzplätze der Welt. Einerseits hat mich die Schweiz freundlich aufgenommen und gefördert, andererseits ist sie mir ein wenig fremd geblieben. Es ist letztlich wie in jeder guten Beziehung: Sie bietet eine Nähe, die nicht erdrückend ist, und eine Distanz, die nicht trennt.