Erfahren wir eigentlich in Deutschlands, was US-Präsident Donald Trump so von sich gibt? Vielleicht nicht wirklich. Denn Trump will erst mal übersetzt werden. Und das ist keineswegs so einfach, wie man glauben könnte.
Als Trump beispielsweise seinen Unmut über die Herkunftsstaaten vieler Migranten mit der Bezeichnung „shithole countries“ zum Ausdruck brachte, rauchten in vielen Übersetzungsbüros die Köpfe. Wie um alles in der Welt soll ein Dolmetscher das zitierfähig ins Deutsche übertragen?
Was bitte sind „shithole countries“?
Ein „Rattenloch“ habe Trump gemeint, hieß es in der französischen Zeitung „Libération“. „Drecksloch-Staaten“ seien es gewesen, vermeldeten viele Medien hierzulande. Die wörtliche Übersetzung von „Shit“ mochte niemand liefern.
Die Dolmetscherin Bérengère Viennot sieht sich seit Trumps Ernennung zum Präsidenten der USA täglich mit solchen Herausforderungen konfrontiert. Und sie beobachtet, wie Kollegen an der Aufgabe einer zuverlässigen, angemessenen Übersetzung verzweifeln.
Trump zu übersetzen – und zwar wirklich, ohne verschämtes Glätten, Anpassen und Verharmlosen –, das müsse man sich trauen, schreibt Viennot in ihrem Buch „Die Sprache des Donald Trump“.
Die Schwierigkeit dieser Aufgabe besteht in einem eigenartigen Widerspruch. Einerseits ist da nämlich ein Wortschatz von geradezu absurder Schlichtheit: Rudimentäre Englischkenntnisse genügen, um den Informationsgehalt der allermeisten Aussagen zu verstehen.
Wörtlich oder übertragen?
Andererseits aber gewinnen gerade deshalb Sekundärfaktoren umso mehr an Bedeutung. Das Problem ist bekannt, etwa von Redewendungen: Wörtlich übersetzt ergibt „I heard it through the grapevine“ (Ich hörte es durch die Weinrebe) im Deutschen keinen Sinn, es bedarf einer zusätzlichen Kenntnis des kulturellen Bedeutungshintergrunds (Es kam mir zu Ohren).
Bei Trump, sagt Viennot, werde dieser Hintergrund häufig ausgeblendet. 2017 begrüßte der US-Präsident bei seinem Staatsbesuch in Paris die Première Dame, Brigitte Macron, mit den Worten: „You‘re in such good shape!“ In vielen Übersetzungen wurde daraus: „Sie sind in guter körperlicher Verfassung!“
Wörtlich stimme das in etwa, sagt Viennot. Tatsächlich könnte man den Satz so übersetzen, wenn es sich bei seinem Schöpfer etwa um einen Physiotherapeuten oder Fitnesstrainer handelte.
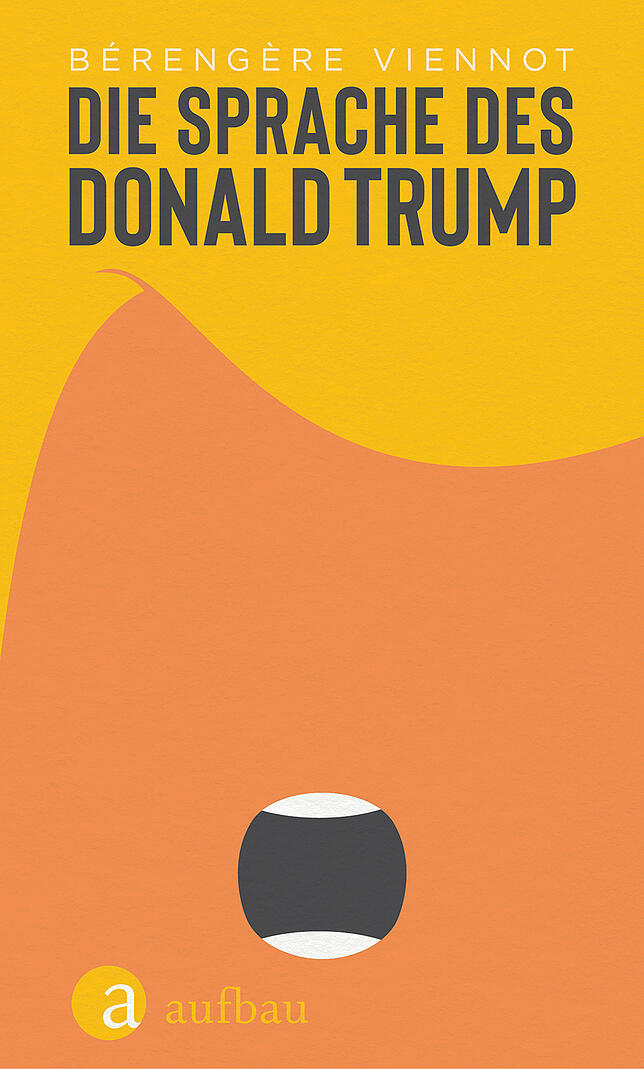
In Kenntnis von Trumps unverhohlenem Sexismus müsse man aber den Gedankengang hinter dem Ausruf berücksichtigen. „Sie haben sich gut gehalten!“, trifft deshalb eher ins Schwarze: Nur so wird die offenkundige Abwertung des weiblichen Alterungsprozesses mit übersetzt. Trump übersetzen, das heißt also, ihn immer auch ein Stück weit zu interpretieren.
Tückisch an der Aufgabe ist, dass bisweilen das Gegenteil gilt: bloß nicht interpretieren! Und zwar dann, wenn es sich nicht bloß um einen knappen Tweet oder eine flüchtige Bemerkung handelt, sondern der US-Präsident ins Reden kommt.
Interpretieren oder lieber nicht?
Ein klassisch geschulter Dolmetscher wird versehentliche Wiederholungen und Syntaxfehler ausbügeln. „Stets der Botschaft treu bleiben, den Gedanken des Autors folgen, einen flüssigen Text verfassen“: Auf diesen Grundsätzen basiere seit Menschengedenken das Handwerk eines guten Dolmetschers, schreibt Viennot.
Bei Trump ist damit nichts zu gewinnen. Botschaften und Gedanken lassen sich in seinen wirren Satzkonstruktionen mit ihren manischen Wiederholungen und abstrusen Wendungen oft kaum erkennen. Umso mehr wird die Art des Sprechens zur Botschaft: Glättend einzugreifen würde nur verfälschen. Der Übersetzer muss versuchen, den Wahnsinn möglichst so holprig zu übertragen, wie er sich selbst zeigt.
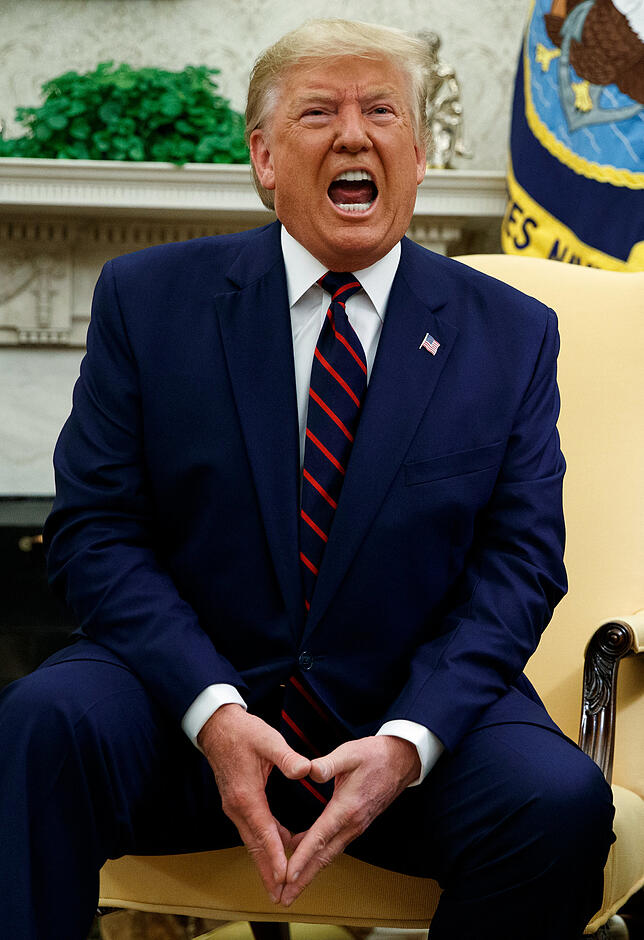
Nicht nur die Grammatik erweist sich als Abgrund. Auch der Wortschatz bereitet Dolmetschern Probleme. Es scheint paradox: Je einfacher ein Wort zu verstehen ist, desto schwieriger ist es zu übersetzen. Zur Verdeutlichung dieses Phänomens führt Viennot ein Interview des US-Präsidenten mit der „New York Times“ an.
41 Mal habe er das Wort „great“ (zum Beispiel großartig) verwendet, 25 Mal „win“ (gewinnen) und 7 Mal „tremendous“ (gewaltig). Sein Wortschatz drehe sich „auf einem begrenzten, mit Superlativen überfrachteten lexikalischen Feld im Kreis“.
Irritierend sei nun, dass diese simplen Wörter keineswegs leicht zu übersetzen sind. Der Grund: „Je präziser, gelehrter und zugespitzter die Begriffe, desto klarer ihre Bedeutung.“ Vielzweckwörter dagegen, wie Trump sie so exzessiv gebraucht, wirkten meist unspezifisch und geradezu sinnentleert.
Schließlich: die Satzzeichen. Sie kommen nur in geschriebenen Äußerungen zur Geltung, das aber häufig genug, und zwar auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Trump nutzt folgenden Zeichen-Code: „Anführungszeichen“ = Zynismus, ????? = Ungläubigkeit, !!!!!!! = extreme Ungläubigkeit, NUR GROSSBUCHSTABEN = Wut. Wer den US-Präsidenten glaubhaft übersetzen will, der muss auch diesen Code kennen.
Es ist nicht leicht, Dolmetscher zu sein
Schade, dass Bérengère Viennot über diese interessanten Einblicke hinaus nur altbekannte Kritikpunkte gegen Trumps Rhetorik vorbringt. Mehr nüchterne Analyse statt persönlicher Empörung hätte dem Essay gut getan. Eine Erkenntnis vermittelt die Lektüre dennoch. Dolmetscher sein in Zeiten der alternativen Fakten und sprachlichen Verrohung – das ist kein leichter Job.







