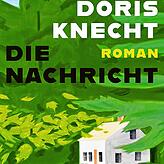Fast jeder zweite Deutsche hütet sich vor freier Meinungsäußerung, eine entsprechende Studie des Allensbach-Instituts sorgte in diesem Sommer für Aufsehen. Was sind das für Zeiten, in denen trotz freier Wahlen und unabhängiger Rechtsprechung tiefe Angst und Misstrauen unser Bewusstsein bestimmen?
Mit aktuellen Debatten um Impfpflicht, Identitätspolitik oder Klimaschutz allein werden sich die Gründe nicht erklären lassen. Einen tieferen Einblick gibt die Literatur, zum Beispiel ein neuer Roman von der österreichischen Autorin Doris Knecht. „Die Nachricht“ lautet sein Titel, dabei sind es eigentlich gleich eine ganze Reihe von Nachrichten, die der Ich-Erzählerin Ruth Ziegler zu schaffen machen.
Es beginnt eines Nachmittags im Postfach ihres Facebook-Accounts. „Weißt du eigentlich von der Affäre deines prächtigen Ehemannes?“, lautet die scheinbar besorgte Frage eines gewissen Ernst Breuer. Und ja, sie weiß von dieser Affäre, die Botschaft selbst kann sie nicht mehr schrecken. Sehr wohl aber die Tatsache, dass jemand anderes davon weiß – auch wenn die Sache lange zurückliegt und der Ehemann inzwischen bei einem Unfall ums Leben kam.
Ernst Breuer ist so schnell wieder in den Tiefen des Internets entschwunden, wie er aufgetaucht war: ein Fake-Profil, angelegt offenbar ausschließlich, um der bekannten Drehbuchautorin einen gehörigen Schrecken einzujagen. Doch damit allein gibt sich der Unbekannte nicht zufrieden.
„Ordentlich durchgevögelt“
Bald kursieren E-Mails an Freunde und Verwandte. Ruth Ziegler, heißt es darin, sei eine, die für jeden die Beine breit macht, „die will mal wieder ordentlich durchgevögelt werden“. Und sie verstören mit frappierenden Detailkenntnissen über das Privatleben. Sie sei wohl hinter dem „geilen Brunner“ her, heißt es etwa. In der Tat: Zu Simon Brunner, renommierter Kinderpsychologe aus der Schweiz, unterhält sie eine On-Off-Beziehung. Wer könnte davon wissen?
Vielleicht die Affäre von damals, Valerie Adler. Eine Frau, die anscheinend bis heute weder über den Tod noch über ihre Eifersucht hinweggekommen ist. Eine Stalkerin aus enttäuschten Hoffnungen, wer weiß, wo so eine überall herumspioniert.
In einer funktionierenden Diskursgesellschaft käme es zu einem persönlichen Gespräch: ein Anruf bei Valerie Adler, der Vorschlag, unter vier Augen über das Vergangene zu sprechen, mögliche Missverständnisse auszuräumen, den Boden für einen Neuanfang zu bereiten. Doch so läuft das heute nicht.
Stattdessen wird erst einmal gegoogelt: Valerie Adler, zu finden auf Instagram, eine Frau in Jeans und Sweatshirt, 403 Abonnenten, 214 Beiträge, viel Natur, Selfies aus komischen Winkeln. „Ich wollte es nicht sehen“, heißt es, „ich fühlte mich zurück beobachtet, als könne sie aus diesem Fenster heraus auch mich sehen.“ Deshalb lieber den Account blockieren. Bloß nicht ansprechen, lautet auch der Rat einer guten Freundin. Valerie Adler könne sich in die Ecke gedrängt fühlen, dann sei gar nichts zu erreichen.
So bleibt das Böse im digitalen Dunkel. Echte Begegnungen sind allein einem vertrauten, wohlgesinnten Umfeld vorbehalten, Freunden, Familienangehörigen, natürlich auch Simon.
Und auch das gilt nur, solange dabei keine Meinungsverschiedenheit stört. Als sich Fernsehkollege Sebastian dazu versteigt, die Erklärung fürs digitale Mobbing im Verhalten des Opfers zu vermuten, endet das Gespräch in Unfrieden und Sprachlosigkeit. „Er likte nicht mehr meine Postings und Tweets, wahrscheinlich hatte er mich gemutet, ich ihn später auch“. Zwar habe er sie „nicht entfreundet“, notiert die Erzählerin: „Er ignorierte mich nur konsequent.“
Dass Valerie Adler nicht wirklich hinter den Stalking-Attacken steht, ahnt der Leser früh, und auch wenn die Identität des wahren Täters nicht allzu schwer zu erraten ist, sei an dieser Stelle ein Spoileralarm angeführt. Tatsächlich entpuppt sich schließlich ausgerechnet der so verständnisvolle Kinderpsychologe Simon als Quelle der mysteriösen Nachrichten. Doch nicht dieser Umstand selbst überrascht, sondern vielmehr das Motiv hinter der Tat.
Unter dem Pseudonym „johnofarc7“ war Simon im Internet nämlich mit Hasskommentaren gegen Feministinnen zu zweifelhaftem Ruhm gekommen. Offenbar hatte Ruth mit einem x-beliebigen Twitterbeitrag in ihm einen perfiden Jagdinstinkt geweckt, sein digitales Spiel in analogen Ernst umschlagen lassen.
Die Indizien sind erdrückend, doch am öffentlichen Bild ändern sie wenig. Der Psychologe parliert weiterhin ungerührt in Talkshows, als wäre nichts gewesen. Unschwer kann man hier eine Anspielung an den Fall Sigi Maurer erkennen: Die österreichische Politikerin hatte 2018 einen Unternehmer als Urheber obszöner Nachrichten enttarnt, wurde anschließend aber wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts zunächst selbst verurteilt.
So berechtigt die Empörung über Typen wie Simon Brunner natürlich ist, die feministische Intention wirkt in dieser Erzählung manchmal sehr appellativ. Dann garantieren Unmittelbarkeit und Deutlichkeit zwar ein leichtgängiges Lektüreerlebnis (der Roman liest sich runter wie nichts). Zurück bleibt aber der Eindruck, vieles allzu leicht verstanden, allzu widerspruchsfrei rezipiert zu haben.
Bemerkenswert ist hingegen die Kommunikationsstruktur dieser Gesellschaft. Knechts Figuren übertragen das binäre Schema der sogenannten sozialen Netzwerke auf ihr analoges Leben. Menschen sind entweder gut oder böse, werden dementsprechend befolgt oder „geblockt“: Die Antennen für Zwischenfrequenzen sind in dieser Welt längst abmontiert. Was bleibt, ist ein rhetorischer Stellungskrieg, in dem mancher zu den schmutzigsten Methoden greift.
Twitter, erkennt die Ich-Erzählerin schließlich, sei kein schöner Ort, „wenn man an die falschen Menschen gerät“. Doch dann korrigiert sie sich: „Es ist überhaupt kein schöner Ort.“