Mit Anfang zwanzig darfst du naiv sein, zum Lernen bleibt dir ja noch fast ein ganzes Leben. Und wenn nicht? Vielleicht ist das Naive dann erst recht eine Rettung.
Sebastian findet Anlässe genug, sich vermeintlicher und tatsächlicher Naivität zu bezichtigen. „Total bescheuert“ findet er sich mitunter, „hochgradig naiv“. Und man möchte der Hauptfigur in Stefan Hornbachs Romandebüt „Den Hund überleben“ (Hanser Verlag) in diesen Momenten kaum widersprechen.
Da sind die Sexabenteuer mit fremden Männern: mal eher zufällig, mal aus plötzlich entbrannter Liebe, selten aber mit Vorsicht und Verstand. Von einer Freundin lässt er sich zum Besuch eines skurrilen Schamanen bequatschen. Und bevor Sebastian aus eigenem Verschulden eine falsche Entscheidung trifft, verlässt er sich lieber auf die aktuelle Anzeige seiner Digitaluhr: Ungerade Ziffern bedeuten ja, gerade nein.
Nein, man möchte diesem Jungen in seiner Selbstkritik nicht widersprechen, ihn verurteilen aber, das möchte man noch weniger. Sebastian ist am Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt, drei Tumore wachsen in seiner Brust. In diesem Alter ist das Leben noch zum Ausprobieren da. Unvernunft soll sich allmählich zu Erfahrung verdichten, der Rausch der Freiheit nach und nach Erkenntnis hervorbringen. Und jetzt ist da nichts mehr zum Ausprobieren, nur ein nüchternes Gesundheitssystem. Blutwerte, MRT-Bilder, Röntgenaufnahmen: Das alles dient dem Überleben, nicht dem Leben.
Es sind zwei konträre Welten, die hier aufeinander prallen. Einerseits die erwachsene, rationale Vernunft, die den Patienten zum disziplinierten „Kämpfen“ auffordert. Andererseits die jugendliche Erfahrungssehnsucht, die auf Kampf gar keine Lust hat, wenn nicht einmal klar ist für oder gegen was überhaupt.
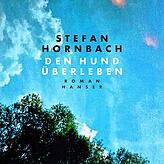
Mit feiner Beobachtungsgabe zeigt der Ich-Erzähler auf, dass auch vermeintlich so abgeklärte Instanzen wie Eltern und Ärzte auf diese Frage keine rechte Antwort wissen. Über den Tod zu sprechen, das fällt schon im höheren Alter nicht leicht: Umso schwieriger gestaltet es sich gegenüber einem Menschen, dessen Leben gerade erst begonnen hat.
Die eine Möglichkeit liegt in Beschwichtigung und Verdrängung. „Wirklich sehr unwahrscheinlich“ sei es, dass Sebastian unter einem sehr komplizierten Syndrom leide, behauptet der Arzt. Gemessen an dieser Aussage mutet sein Tonfall merkwürdig euphorisch an, als er schließlich das Ergebnis der Gewebeprobe mitteilt: Es ist tatsächlich nicht dieses Syndrom, sondern einfach nur Krebs! Wie schön!
Die besorgte Mutter spielt Theater, will den Jungen mit Durchhalteparolen beruhigen. „Na, dann warten wir doch erst mal ab“, pflegt sie mit fester Stimme zu sagen. Und: „Tumor ist ja auch nur ein anderes Wort für Geschwür.“ Hilft so etwas, wenn du dein Leben entgleiten siehst?
Die andere Möglichkeit, eine direkte Ansprache ohne Rücksicht auf Verluste, wählt Dr. Mittag, erfahrene Oberärztin an der Uni-Klinik. „Junger Mann“, raunzt sie ihn an: „Hat man Ihnen schon gesagt, dass Sie eine Chemotherapie machen müssen?“ Und: „Junger Mann, mir tut‘s ja auch leid. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir das nächste halbe Jahr miteinander verheiratet sein werden!“ Ist das wirklich besser?
Eine Stärke dieses Romans ist, dass er sich einer Bewertung oder gar Verurteilung der unterschiedlichen Verhaltens- und Sichtweisen entzieht. Was falsch ist und was nicht, das hängt am Ende vom Patienten ab: von seinem Charakter, seinem Umfeld. Sebastian, so wird bald deutlich, kann zur raubeinigen Dr. Mittag Vertrauen aufbauen. Das liegt aber auch daran, dass er für alles Widersprüchliche, Emotionale, Irrationale abseits der Klinikwelt einen Resonanzraum findet.
Dieser Resonanzraum besteht aus Freunden und Verwandten, die ihm rührend ahnungslose Fragen stellen (“‘Du hast Leukämie oder?‘, fragte sie als ginge es um mein Studienfach“) oder in bester Absicht ausgerechnet Tarot-Karten legen (“Der Tod, zumindest im Tarot, habe gar nichts Schlechtes zu bedeuten, erklärte Jasna voller Überzeugung“). Es sind Menschen, die vieles verkehrt machen und genau dadurch alles richtig.
Selbst sein kurzzeitiger Freund Linus spielt in diesem Stück eine wichtige Rolle, gerade weil er sich so überhastet, so verantwortungslos vom Acker macht. Dabei hatte er Sebastian gerade erst die große Liebe vorgespielt hat und sogar am Frühstückstisch der Eltern gesessen. An seinem „verletzlichsten Punkt“ habe Linus ihn erwischt, erkennt Sebastian rückblickend. Die Eltern mögen seinem Beziehungsleben ähnlich unsicher, ratlos gegenüber stehen wie seiner Krankheit (“Du und der Linus, ihr habt jetzt also ein Verhältnis?“): Davonlaufen aber werden sie nicht.
Und so handelt diese Geschichte weniger von Krankheit und Tod als vom Erwachsenwerden. Stefan Hornbach erzählt davon in einem wunderbar leichten, von milder Ironie gefärbten Ton. Dass hinter einer solch präzisen Sprache autobiografische Erfahrungen stecken müssen, wird früh klar: Über einen reinen Erlebnisbericht reicht das Werk aber weit hinaus.
Wenn Sebastian schließlich den Hund überlebt – wie der Romantitel ankündigt –, so ist damit nicht etwa ein Tumor gemeint, sondern das Haustier seiner Eltern. Es war schon alt und schwach geworden, auch in seinem Körper wucherte etwas. Doch alt, das heißt bei einem Hund 13 Jahre. Ob ein Leben kurz ist oder lang, das bemisst sich nicht an absoluten Zahlen, sondern allein an einer Erwartung. Und vielleicht verhindert die menschliche Erfindung des Abmessens von Zeiteinheiten nur den Blick aufs Wesentliche: Dass es auf ein Überleben gar nicht ankommt, weil allein das Leben zählt.









