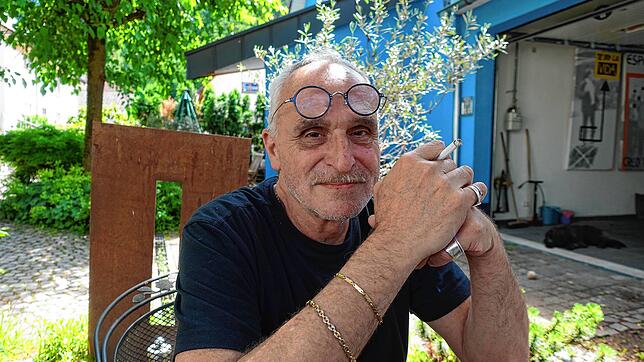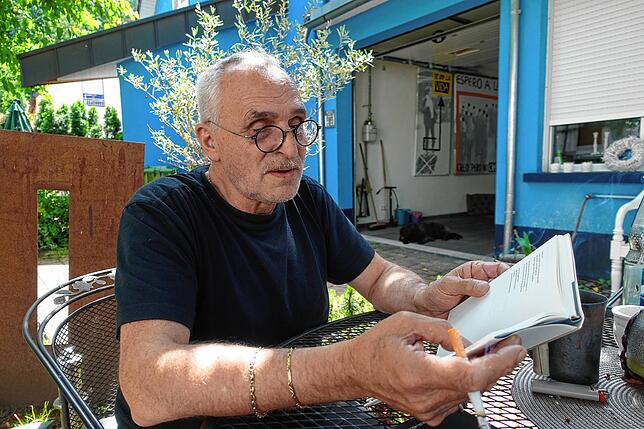Herr Oliver, Sie sind in Hausach im Schwarzwald geboren und leben hier. Ihre Eltern kamen 1960 als Gastarbeiter aus Andalusien hierher. Fühlten sich Ihre Eltern willkommen?
Meine Mutter sagte mir einmal, sie habe sich damals sehr wohl in Deutschland gefühlt, weil sie nicht jedes Wort verstanden habe. So konnte sie in der Illusion leben, willkommen zu sein.
Wie haben Sie als Kind Ihr Anderssein empfunden? Für die Hausacher waren Sie ja ein „Riigschmeckter“, ein Fremdling, wie Sie in Ihrem Buch „Mein andalusisches Schwarzwalddorf“ schreiben. Hatten Sie Probleme mit der Sprache?
Ich hatte das große Glück, mit zwei Müttern aufzuwachsen. Ich bin in zwei Sprachen geliebt worden. Bei der deutschen Ziehmutter, die uns Kinder betreute, wenn die Eltern in der Fabrik arbeiteten, sprach ich Alemannisch und Deutsch, zu Hause Andalusisch und Spanisch. Sicher: Es gab auch Ausgrenzung, aber eigentlich bin ich angenommen worden, sonst wäre ich nicht der, der ich bin. Egal, wo ich auf der Welt gelebt habe, ich habe nie die Wohnung im Schwarzwald aufgegeben. Alles was ich geschrieben habe, hat hier stattgefunden.
Haben Sie sich aktiv gegen die Ausgrenzung engagiert?
In den 1980er Jahren, als es um das kommunale Wahlrecht für Ausländer ging, bin ich mit Cem Özdemir durch die Lande gezogen. Er mit dem Parteiprogramm, ich mit der Gitarre und habe meine Gedichte vorgetragen. Ich habe mich nicht beirren lassen und war letzten Endes einer von ihnen, der hier geboren wurde und aufgewachsen ist. Was mir hier gefehlt hat, war die Literatur. Also habe ich das Festival Hausacher LeseLenz gegründet, das jetzt zum 24. Mal stattfindet und mittlerweile eines der renommiertesten ist.
Ihre Lyrik verlangt vom Leser Arbeit. Warum schreiben Sie so vieldeutig?
Gedichte sind für mich Partituren, man muss sie laut lesen. Ich schreibe nur, wenn ich von etwas berührt werde. Ich gebe Ihnen einen Einblick in meine Werkstatt: Ich schreibe mir eine Notiz auf, daraus kann ein Notat entstehen, immer noch handschriftlich. Wenn es ans Tippen geht, entsteht so etwas wie eine Verdichtung. Erst danach wird es manchmal ein Gedicht.
In meinen Texten werden Sie alles finden. Auch das Fragment ist eine Kunst. Manchmal reicht mir die deutsche Sprache nicht aus, dann muss ich Worte neu schöpfen. „Betrachte die Wörter wie Bilder“, hat mich meine Ziehmutter gelehrt. Das Wort „wundgewähr“, der Titel meines Gedichtbandes, meint die Gewähr einer Wunde. Das ist die einzige Gewähr, die es im Leben gibt, die einzige Kontinuität. Irgendwann habe ich festgestellt, dass in Worten oft andere Worte stecken. So entstand der Oliver‘sche Doppelpunkt, wie ihn die Literaturkritik nennt. In „Wort“ steckt ja auch „Ort“, also schreibe ich W:ort oder gem:einsam oder sch:reibe oder w:erden.
Kann Ihre eigenwillige Lyrik nicht auch Barrieren schaffen oder Unverständnis hervorrufen?
Man muss die Angst abbauen, dass man etwas nicht begreifen könnte. Ich arbeite ja auch viel mit Schülern. Da schreibe ich zum Beispiel „Fernlautmetz“, meinen ersten Buchtitel bei Suhrkamp, an die Tafel. Dann finden wir: Das ist der Hauer der fernen Laute. Ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen Poesie ist.
Muss man eine Sprache denn komplett kennen, um zur Gemeinschaft zu gehören?
Für mich gibt es keine defizitäre Sprache. Ich arbeite auch mit geflüchteten Kindern. Selbst wenn sie nur fünf Wörter kennen, dann sind diese fünf Wörter hundert Prozent. Sprache erweitert sich ja ständig. Wittgenstein sagt: Sprache identifiziert den Menschen, schenkt ihm Identität. Er vergleicht es mit einer Stadt, die ständig wächst. In einer Abiturklasse schreibt ein Schüler „Glücksehligkeit“ als Mutation des Wortes Glückseligkeit. Er erklärt: Das ist doch das Glück, das ich sehe. Vielleicht muss der Duden diese Schreibweise mit aufnehmen.
Kann Dichtung die Gesellschaft verändern?
Das Buch, das mich Anfang der 90er Jahre bekannt machte, war der „Gastling“. Es war meine Antwort auf Mölln und Solingen (die rechtsextrem motivierten Anschläge, Anm. der Redaktion). Danach bekam ich Morddrohungen und ich habe unter Polizeischutz gelesen. Seehofers problematischer Satz „Die Migration ist die Mutter aller Probleme“, den er gar nicht so gemeint hatte, ließ meine Mutter ausrufen: Jetzt haben sie es schon wieder mit uns. Hilde Domin hat gesagt: Abel hätte Kain nie den Rücken zukehren dürfen. Ich lebe gerne in diesem Land. Aber es gibt auch jetzt wieder Entwicklungen, dass ich wach bleiben muss und all meine Kraft verwenden, so zu leben, dass es beispielhaft sein kann für Menschen, wie Zusammenleben funktioniert. Dichter ist für mich eine Seinsform.