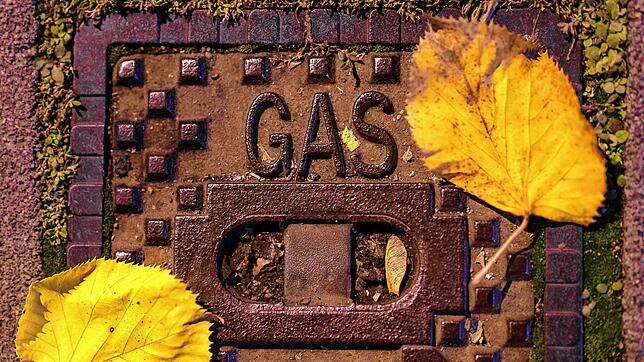Herr Wolf, Sie halten nichts von der angedachten Gaspreisbremse. Warum nicht?
Wir sind durchaus dafür, den Gaspreis zu deckeln, um eine Überbelastung zu verhindern. Nur die Art und Weise, wie die Deckelung gestaltet werden soll, kritisieren wir. Denn die Versorgungssicherheit wird damit nicht gefördert, sondern eher gefährdet. Wenn 80 Prozent des Verbrauchs mit einem Fixpreis gedeckelt sind, gibt es keinen Anreiz, um weiter zu sparen. Gerade, wenn man den Preis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde deckelt, was weit unter dem Marktpreis liegt. Zudem werden ärmere Haushalte stärker belastet.
Warum ist das so?
Vorgesehen ist ja eine Preisdeckelung für 80 Prozent des Gasverbrauchs, der sich allerdings am individuellen Vorjahresverbrauch orientiert. Ärmere Haushalte, die über weniger Wohnfläche verfügen, also auch weniger Energie verbrauchen, bekommen also auch weniger subventioniert, obwohl gerade sie mehr Unterstützung bräuchten. Wer ohnehin am Existenzminimum lebt und seinen Verbrauch schon zuvor stark eingeschränkt hatte, wird mit dem Preisdeckel von zwölf Cent immer noch stark belastet. Immerhin geht es hier um eine Verdopplung des Kilowattpreises. Das können nicht alle schultern.
Wie kann es besser gehen? Sie haben ein eigenes Modell entworfen, wie es gelingen könnte. Wie sieht das genau aus?
Uns schwebt ein gestaffelter Gaspreisdeckel vor. Das heißt, der Preis würde innerhalb der 80 Prozent nicht bei zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen, sondern geringerer Verbrauch wäre noch günstiger, während höherer Verbrauch mehr kosten würde – eine Staffelung also.
Was wäre der Vorteil?
So entstehen zusätzliche Sparanreize: Je mehr die Haushalte einsparen, umso geringer fällt der Kilowattstundenpreis aus. Das schafft auch zusätzliche Einsparanreize. Und es wäre gerechter, wenn man Referenzverbrauch nicht am individuellen Vorjahresverbrauch festmachen würde, sondern anhand des Durchschnittsverbrauchs eines Haushalts. Damit würden kleinere Wohnungen und ärmere Haushalte dann auch eher profitieren.
Wie ließe sich das praktisch umsetzen?
Der Gaspreisdeckel – egal in welcher Form – hat generell ziemlich hohe technische Hürden, egal in welcher Form. Das Hauptproblem sind die Mehrfamilienhäuser. Dort kann man nicht in Echtzeit messen, wie viel verbraucht wird. Man weiß nur, wie viel der Anschluss verbraucht, nicht aber den Verbrauch der einzelnen Wohnungen. Das macht die Gaspreisdeckelung auch hier ungerecht. Das sollte technisch verbessert werden.
Wie funktionieren dann die Abrechnungen?
Der Vorschlag der Gaskommission ist es ja, zweistufig vorzugehen. Als Überbrückung und zur Entlastung sollen erst einmal die Abschlagszahlungen vom Dezember komplett übernommen werden. Wir dagegen wollen den Abschlagspreis deckeln, also das, was Versorger von Verbrauchern verlangen können. Im Gegenzug würden die Versorger entschädigt für die Differenz zum Marktpreis. Zusätzlich sollten Vermieter die Mieter direkt entlasten, die weniger verbrauchen – also schon vor der tatsächlichen Jahresabrechnung.

Wie soll das funktionieren? Das wäre ja ein erheblicher Aufwand für die Vermieter …
Die Vermieter könnten die Einsparungen, die ihnen aus der Deckelung des Abschlagspreises entstehen, auf Grundlage der bekannten Vorjahresverbräuche unmittelbar an ihre Mieter verteilen. Der administrative Aufwand hielte sich so in Grenzen. Zum Zeitpunkt der jährlichen Gas-Abrechnung würden die verteilten Vorabzahlungen dann mit den verbrauchsabhängigen Preissubventionen verrechnet. So wäre sichergestellt, dass die Vorabentlastungen nicht die Anreize zum Energiesparen hemmen.
Haben Sie das Modell der Bundesregierung vorgelegt beziehungsweise deren Expertengremium?
Wir stehen in der Tat in Kontakt mit Mitgliedern der Gaskommission. Unser Vorschlag ging auch in die Beratungen ein, wenn auch eine andere Entscheidung gefallen ist. Das Gremium steht ja unter einem gehörigen Zeit- und politischen Druck. Wenn Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wissenschaft zusammenkommen, greift oft die Regel des Minimalkonsens. Die aktuelle Lösung hat aber einigen Verbesserungsbedarf.
Wie kann das noch gelingen, wenn die Änderungen bis zum Monatsende kommen müssen, weil sonst das bisherige Gesetz mit Gasumlage und Preisaufschlägen von den Gasanbietern umgesetzt werden muss?
Durch den Vorschlag der Kommission sind die Vorgaben für die nächsten Monate praktisch gesetzt. Aber man darf nicht nur für die nächsten Winter planen, sondern muss auch den übernächsten berücksichtigen.
Wie schätzen Sie die Versorgungslage für den nächsten Winter ein?
Das große Risiko besteht weniger für die Versorgungssicherheit in diesem Winter 2022/2023, sondern eher für die des Winters 2023/2024. Weil die Frage ist, wie die Gasspeicher bis zum nächsten Sommer gefüllt sein werden. Unsere Gasspeicher sind nicht darauf ausgerichtet, einen ganzen Winter zu überbrücken, sondern von einem regulären Gaszufluss abhängig. Sparanreize müssen da sein, sonst besteht ein erhebliches Risiko, dass wir diesen Winter zwar noch gut überstehen, aber dafür sehenden Auges auf eine Katastrophe im nächsten zusteuern
Die EU-Kommission hat ihre eigenen Vorstellungen, wie der Gaspreis geregelt werden kann. Inwieweit verhindert er einen deutschen Gaspreisdeckel?
Die von der EU-Kommission vorgeschlagene dynamische Gaspreisobergrenze bezieht sich auf die Preise im Großhandel, bei den in Deutschland diskutierten Lösungen geht es hingegen um die Endverbraucherpreise. Insofern ist die Umsetzbarkeit eines deutschen Gaspreisdeckels davon nicht unmittelbar berührt.
Und mittelbar?
Mittelbar besteht schon ein Zusammenhang über die Sicherheit der Gasbeschaffung. Wie andere Institute machen auch wir uns Sorgen um die Auswirkungen eines Preisdeckels im Großhandel für die Versorgungssicherheit in extremen Gasnotlagen. In dieser Hinsicht sehen wir uns mit unserem Konzept eines dynamischen Gaspreisdeckels für die Endverbraucherpreise bestätigt: Sind die Großhandelspreise gedeckelt, wird es umso wichtiger, auf Ebene der Endverbraucher Energiespar-Anreize zu setzen.
Welche Vorteile hat dabei eine EU-weite Regelung?
Grundsätzlich ist der Gedanke einer EU-weiten Regelung mit Blick auf die Aufrechterhaltung eines europäischen Binnenmarktes sinnvoll. Aus unserer Sicht sollte die europäische Kooperation aber primär bei der Beschaffung ansetzen, das heißt bei den ebenfalls vorgeschlagenen Vorgaben für eine gemeinsame Einkaufspolitik.

Wie schnell lässt sich das überhaupt umsetzen? Die Mitgliedstaaten müssten ja erst zustimmen und ein gemeinsamer Einkauf dürfte für viele der nationalen Souveränität entgegenstehen. Wie sehen Sie das?
Der Faktor Zeit ist hier in der Tat die größte Herausforderung. Angesicht der national unterschiedlichen Bedrohungslagen werden auch nicht alle Mitgliedstaaten gleichermaßen die Neigung verspüren, sich einer gemeinsamen Einkaufspolitik zu unterwerfen. Auf der anderen Seite könnten aber letztendlich alle Länder von niedrigeren Einkaufspreisen profitieren.
Und die Knappheit der Zeit erzeugt natürlich auch einen hohen Konsensdruck, schließlich will am Ende kein Staat die Schuld für einen Gas-Versorgungsengpass zugeschoben bekommen. Vor diesem Hintergrund bin ich vorsichtig optimistisch, dass zumindest im Hinblick auf die Einkaufspolitik eine schnelle Einigung möglich ist. Ob auch der Gaspreisdeckel durchkommt, ist angesichts des anhaltenden Widerstands von Ländern wie Deutschland allerdings fraglich.
Wieso will die Bundesregierung denn auf nationaler Ebene eine Deckelung, lehnt sie aber auf europäischer Ebene ab?
Die Bundesregierung argumentiert hier primär über die Versorgungssicherheit: Wird der Beschaffungspreis in Europa gedeckelt, besteht die Gefahr, dass die Händler in Notsituationen knappes Gas gar nicht erst in Europa auf den Markt bringen, weil sie es anderswo teurer verkaufen können. Die Versorgungsnot würde so gerade in solchen Extremsituationen noch verschlimmert.
Wenig überraschend steht deshalb vor allem Deutschland auf der Bremse, da das Versorgungsrisiko hier besonders hoch ist. Andere Länder, die ihr Gas bislang zu geringeren Teilen aus Russland bezogen haben, stehen dem positiver gegenüber, da ihre Versorgungslage weniger prekär ist. Primäres politisches Ziel ist für sie die Eindämmung der Preisanstiege.

Wie wird sich der Gaspreis Ihrer Einschätzung nach mittel- und langfristig entwickeln?
Mit Blick auf die nächsten Monate spricht weniger dafür, dass wir eine deutliche Reduktion der Preise sehen sollen, der Energiehunger ist nach wie vor hoch. Sicherlich hat Deutschland als Exportland auch dazu beigetragen, dass die Preise so gestiegen sind. Das Preisniveau wird in den nächsten Monaten sicher hoch bleiben, vielleicht sogar noch steigen.
Und langfristig?
Langfristig hängt es davon ab, wie konsequent wir den Umstieg auf alternative Energiequellen angehen, Bio-Methan, Direktverstromung anstelle von fossilen Quellen, das müssen wir konsequent vorantreiben, dann sinkt auch wieder die Nachfrage nach fossilen Quellen, was einen preissenkenden Effekt hat. Das muss jetzt konsequent angegangen werden.
Wie sieht die ideale Energieversorgung der Zukunft aus?
Sie ist auf Energieeffizienz ausgerichtet: Wir brauchen Technologien, die den Energiebedarf minimieren. Und wir brauchen einen Mix aus verschiedenen grünen Energieträgern: Strom aus Wind-, Solar- und Wasserkraft, aber auch grüner Wasserstoff und Bio-Methan. Nur dann kann die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern gelingen.