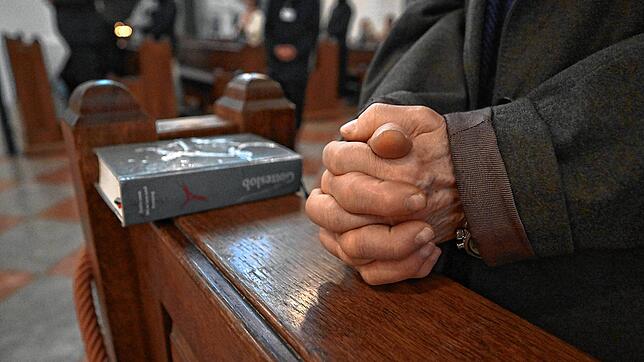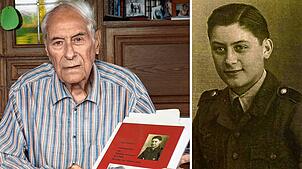Das Wort zum Sonntag ist am 1. Mai 71 Jahre alt geworden, im Alter zusammengeschrumpft (auf vier von ehemals zehn Minuten), aber immerhin noch gesehen von 1,2 Millionen Zuschauern, oder vielleicht auch nur ertragen als unvermeidlichen Füller zwischen Tagesthemen und Samstagnachtthriller.
Angesichts der Tatsache, dass inzwischen weniger als die Hälfte der Deutschen einer christlichen Kirche zugehören, könnte man auf den Gedanken kommen, das Wort zum Sonntag einfach zu streichen. 1,2 Millionen sind aber immer noch 1,2 Millionen potenziell wütende Gebührenzahler, die will man nicht unnötig verprellen zu solch später Stunde.
Zahl der konfessionell geprägten Wähler schrumpft
Anders Julia Klöckner, die sich zuletzt mit den christlichen Kirchen offensiv angelegt hat. Die Motivlage könnte bei ihr allerdings eine ganz ähnliche sein: Auch die Zahl der konfessionell gebundenen Wähler schrumpft stetig. Gar nicht so abwegig also, dass sich die CDU zu den Kirchen ein wenig kritische Distanz aufbaut. Die ablehnende Haltung der neuen Bundestagspräsidentin kommt jedenfalls nicht aus heiterem Himmel.
Tatsächlich hat CDU-Vordenker der Historiker Andreas Rödder, der der Partei nach dem Machtverlust 2021 mit seiner Wahlanalyse den Weg der inhaltlichen Neuaufstellung wies, sogar empfohlen, das C aus dem Namen der C-Parteien zu streichen.
In einer zunehmend entchristlichten Gesellschaft könne das C eine Barriere für Nichtchristen sein, so Rödders Argument, dem parteiintern von vielen widersprochen wurde. Rödder, den übrigens Julia Klöckner in Rheinland-Pfalz in ihr Schattenkabinett geholt hatte, war zeitweise Teil der CDU-Grundwertekommission.
Entfremdung auch bei den Inhalten
Wenn Klöckner die Kirchen dazu auffordert, sich mehr ums Seelenheil denn um Politik zu kümmern, kommt darin aber auch eine Entfremdung auf anderer Ebene zwischen den C-Parteien und den Kirchen zum Ausdruck: es geht um Inhalte.
Mehrere Bistümer und Landeskirchen bekennen sich inzwischen zum Klimaschutz, bauen Solaranlagen auf die Kirchendächer und sprechen sich zum Beispiel für ein Tempolimit aus. Zumindest Letzteres steht nicht im Einklang mit der Mehrheitsmeinung in der Union. Man kann sich sicherlich fragen, ob das Tempolimit den kirchlichen Einsatz wert ist. Grundsätzlich aber sollte sich die Kirche kritischer Äußerungen nicht enthalten.
Jesus war auch politisch
So kurz nach Ostern darf man sich ruhig in Erinnerung rufen, unter welchen Vorzeichen Jesus einst ans Kreuz genagelt wurde. Er war den römischen Machthabern politisch unbequem. Und ganz davon abgesehen hatte seine Botschaft (Nächstenliebe) immer einen politischen Kern. Das ist das Erbe der Kirchen, das diese allzu oft nicht ausgefüllt haben. Besonders während der Nazi-Zeit hielten sie sich mit politischer Bewertung zurück. Dass das ein fataler Fehler war, wird wohl auch in Unionskreisen nicht bestritten.
Nun aber sind die Kirchen der Union zu links geworden, auch weil sie weiter nach rechts gerückt ist. Vor der Bundestagswahl sorgten die Kirchen mit Statements gegen die menschenverachtende Asylpläne der AfD für Aufsehen. Deren völkischer Nationalismus sei für Christen nicht wählbar.
Wie christlich ist das Zustrombegrenzungsgesetz?
Für weniger Furore sorgte, dass auch gegen die Union Position bezogen wurde. Die gemeinsame Abstimmung von CDU/CSU mit der AfD blieb nicht unwidersprochen. Mehr noch, auch die Inhalte des so genannten „Zustrombegrenzungsgesetzes“ des kommenden Kanzlers Friedrich Merz stoßen auf Widerstand. Ein gemeinsames Papier von Berliner Vertretern der Evangelischen Kirche in Deutschland und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz nimmt Stellung dagegen.
Es knirscht also gewaltig in der alten Liaison zwischen Kirchen und C-Parteien. Man hat sich offenbar auseinandergelebt. CDU und CSU haben die Debatte um das Christliche in ihren Parteinamen zwar offiziell beendet. Ob das christliche Alleinstellungsmerkmal heute noch mehr als nur ein Marketing-Gag ist, müssen die Christdemokraten und Christsozialen aber erst wieder beweisen. Gerade sieht es nicht danach als, als ob das bald geschehen würde.