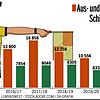Herr Berger, die Gewalt im Fußball nimmt gefühlt immer mehr zu. Welche Gründe hat dies aus Ihrer Sicht?
Es ist nicht der Fußball. Die Probleme, die gehäuft auftreten, haben ihre Wurzeln in unserer Gesellschaft. Da gefühlt jeder Fußball spielt, äußert sich die Problematik aber verstärkt in dieser Sportart. Dieser Sport ist wie ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und diese hat sich zum Negativen verändert, was sich auch durch die Corona-Pandemie verstärkt gezeigt hat.
Inwiefern?
Wir entwickeln uns zu Egomanen, die nur auf sich schauen, auf ihren eigenen Vorteil. Die Pandemie hat dies noch deutlicher sichtbar gemacht. Der Andere wird nicht mehr respektiert. Dadurch leidet das Miteinander, was sich auch im Fußball widerspiegelt. Er ist wie ein Brennglas, das alles verstärkt. Ich wohne seit 30 Jahren direkt neben einem Fußballplatz und erlebe hautnah mit, wie sich allein der Umgangston verändert hat. Gewalt muss nicht physisch sein, das geht schon bei der Sprache los.

In Ihrem Anti-Gewalt-Training im Bereich Jugendfußball am Samstag auf der Insel Mainau wenden Sie sich an Schiedsrichter und Trainer. Die Aggressionen kommen aber doch eher von Spielern und manchen Eltern, während Schiedsrichter oft die Opfer sind.
Ich arbeite nicht mit Tätern. Die kann man meist nicht überzeugen. Es geht mir darum, die Opfer in den Vordergrund zu stellen, sie zu schützen und ihnen das Rüstzeug zu vermitteln, um Aggression zu vermeiden, gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Wie funktioniert das bei Schiedsrichtern?
Die müssen klare Grenzen aufzeigen. Das fängt schon bei der Körpersprache an. Wenn ich sehe, wie manche Schiedsrichter im Profifußball von Spielern hautnah bedrängt werden, habe ich dafür kein Verständnis. Da müssen die Schiedsrichter gegenwirken, den Spielern zeigen, bis hierhin geht es und nicht weiter.
Und die Trainer?
Denen versuche ich zu vermitteln, dass sie ihren Spielern klare Anweisungen geben, aber gewaltfrei kommunizieren. Kein „lauf schneller, du Fettsack“, sondern „hol dir den Ball“. Schiedsrichter und Trainer sind zwar keine Therapeuten. Sie können jedoch durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass Konflikte vermieden werden. In der Pflicht bei der Gewaltprävention sind aber auch die Sportvereine.
Was können die dazu beitragen?
Indem sie Sicherheitsmaßnahmen wie den richtigen Abstand zwischen Zuschauern und Spielfeld einhalten. Und indem sie klarmachen, dass sie Gewalt in jedweder Form auf dem Fußballplatz nicht dulden. Dazu gehört auch, dass es Konsequenzen hat, wenn Grenzen überschritten werden. Da müssen Vereine auch mal Spieler sperren oder Zuschauer ausschließen.
Beim Thema Gewalt im Fußball ploppt auch in schöner Regelmäßigkeit die Frage der Herkunft auf. Manche behaupten, dass Fußballer mit Migrationshintergrund eher zu Undiszipliniertheiten neigen, während diese sich oft von Schiedsrichtern und Gegenspielern benachteiligt fühlen. Wie sehen Sie das?
Es geht nicht darum, ob die Bereitschaft, unfair zu spielen, bei Ausländern größer ist, auch wenn es hierzu Studien und Statistiken gibt. Ein Problem aus meiner Sicht ist eher die große Zahl an ausländischen Fußballvereinen. Da spielt dann nicht der FC Soundso gegen den SV Irgendwas, da spielen dann Türken gegen Deutsche oder Albaner gegen Serben. Gesellschaftliche Konflikte verschiedener Nationalitäten werden auf dem Fußballplatz ausgetragen. Das fördert nicht das Miteinander und das Zusammenwachsen in unserer Gesellschaft, sondern ist Gift für die Integration.
Wie kommt ein gelernter Werkzeugmacher dazu, sich dem Thema Gewaltvermeidung zu verschreiben?
Ich hatte zu Beginn meines Berufslebens mit Maschinen zu tun, habe dann aber schnell gemerkt, dass mein Herz für die Menschen schlägt und als Erzieher gearbeitet. Ich habe mich früh in der Heimerziehung für ein Umdenken eingesetzt. Statt der Massenunterbringung in der sterilen Heimatmosphäre ist es für Menschen mit Problemen besser, in kleinen Gruppen in einer normalen Wohnumgebung zu leben. Dort können ihnen klare Anweisungen gegeben werden, wie sie sich anderen gegenüber respektvoll zu verhalten haben. Und das gilt auch für eine Einheit wie eine Fußballmannschaft. Mit klaren Regeln kann dieser Sport dazu beitragen, dass das faire Miteinander gefördert wird, indem man gegen einen anderen sportlich kämpft, ihn aber gleichzeitig respektiert.